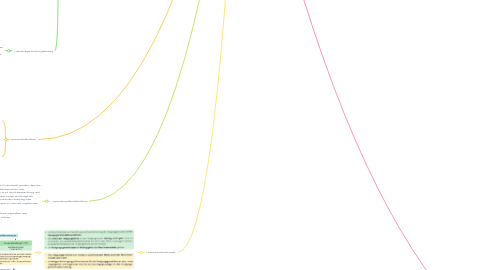
1. Der rote Faden Um die wirkliche Leistung eines Betriebes zu bewerten, müssen wir alles was nicht zum eigentlichen Betriebszweck gehört aus den Zahlen der FIBU „rausrechnen“. Und alles was wir mit einem anderen Wert dargestellt werden muss (z.B. Opportunitätskosten, oder kalkulatorischer Zins) muss ermittelt und in die KLR übernommen werden. In weiteren Schritten werden dann mit dem BAB die Kosten ermittelt und auf Kostenstellen und Kostenträger umgelegt, damit eine genauere Analyse der Produktionskosten und der Planung vorgenommen werden kann. Im weiteren Verlauf wird dann mit den ermittelten Daten aus der Kostenstellen und -trägerrechnung der Verkaufspreis ermittelt oder es werden z.B. Mindestverkaufpreise ermittelt (oder Gewinn / Verlust), wenn man sich in einer Konkurrenzsituation befindet (Zuschlagskalkulation, Divisionkalkulation, Deckungsbeitragrechnung). Mit der Plankostenrechnung können Produktionen geplant und überwacht werden, indem Beschäftigungsabweichungen und -verbrauchsabweichungen ermittelt werden, womit wiederum nach Ursachen geforscht werden kann. Das alles dient zum Erhalt der Rentabilität und der Wettbewerbsfähigkeit -> ein gutes Controlling ist enorm wichtig für ein Unternehmen!
2. Rechnungsabgrenzung BAB
2.1. Ziel: Neutrale, nicht mit dem Betriebszweck zusammenhängende Erträge und Aufwendungen herauszufiltern um das eigentliche Betriebsergebnis zu erhalten. Damit kann dann die Leistung des Betriebs gemäß seinem Betriebszweck ermittelt werden. Diese Ergebnisse dienen auch dem Vergleich, der Planung und der Steuerung des Betriebes (Controlling).
2.1.1. New node
2.2. Rechnungskreis I = Finanzbuchhaltung (HGB)
2.2.1. siehe externes Rewe
2.3. Rechnungskreis II = INTERNE Sichtweise
2.3.1. Abgrenzungsrechnung
2.3.1.1. Unternehmensbezogene Abgrenzung
2.3.1.1.1. neutrale Aufwendungen werden herausgefiltert um die "wahre" Leistung des Unternehmens (betriebszweckgebunden) zu erhalten
2.3.1.1.2. Beispiel: Diskonterträge, Mieterträge, Verluste aus Abgang von AV,...
2.3.1.2. kostenrechnerische Korrekturen
2.3.1.2.1. Hier werden kalkulatorische Kosten aufgenommen um die "richtigen" Werte für die KLR (Betriebsrechnung / Betriebsergebnis) zu erhalten. Die kalkulatorischen Kosten sind nicht in der FiBu enthalten und müssen addiert werden (z.B. Unternehmerlohn in einer Personengesellschaft)
2.3.2. kalkulatorische Abschreibung
2.3.2.1. hier wird der WBW berücksichtigt, der bei der bilanziellen Abschreibung keine Anwendung findet. Diese Aufwendungen müssen aber in die Verkaufspreise einfließen um die Anlagen und Maschinen (AV) refinanzieren zu können.
2.3.2.1.1. Merke
2.3.2.1.2. New node
2.3.3. kalkulatorischer Zins
2.3.3.1. Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals, als Ausgleich für möglicherweise am Markt erwirtschafteten Zinsen des EK
2.3.3.1.1. orientiert sich meist nach dem marktüblichen Zinssatz für langfristiges FK. Kalk. Zinsen sind Anderskosten.
2.3.3.2. betriebsnotwendiges Kapital
2.3.3.2.1. New node
2.3.3.3. Merke
2.3.4. kalkulatorisches Wagnis
2.3.4.1. Einzelwagnisse
2.3.4.2. Die Höhe der kalkulatorischen Wagniszuschläge richtet sich nach entsprechenden Erfahrungswerten. In der Regel wird aus den betreffenden Wagnisverlusten der letzten fünf Jahre ein Durchschnittswert in Prozent ermittelt.
2.3.5. kalkulatorischer Unternehmerlohn
2.3.5.1. Ausgleich für Leistung der Inhaber einer Personengesellschaft oder Einzelunternehmen, die kein Gehalt beziehen. Die Höhe richtet sich i.d.R. nach den Gehältern in vergleichbarer Position. Kalk. U-Lohn sind Zusatzkosten!
2.3.5.1.1. Merke
2.3.6. Kostenrechnerische Korrekturen durch Verrechnungspreise
2.3.6.1. Die Bewertung zu Anschaffungskosten hat den Vorteil, dass die tatsächlichen Werkstoffkosten in die Kostenrechnung eingehen. Nachteilig ist aber, dass die Anschaffungspreise der Werkstoffe im Zeitablauf starken Schwankungen am Markt unterliegen können. Dadurch werden die Werkstoffkosten für gleiche Verbrauchsmengen in den einzelnen Abrechnungsperioden unterschiedlich hoch angesetzt, sodass Kostenvergleiche nicht ohne Weiteres durchführbar sind
2.3.7. kalkulatorische Miete
2.3.7.1. New node
3. Kostenartenrechnung
3.1. Ziel ist es die Kosten verursachungsgerecht zuzuordnen, damit die Preise entsprechend kalkuliert werden können. Dies dient der Deckung der Kosten und der Kalkulation des Verkaufspreises (natürlich mit Gewinn).
3.1.1. Teilkostenrechnung: Kosten verursachungsgerecht auf die Erzeugnisse umlegen, möglichst genau auf das einzelne Produkt. Dafür ist die Spaltung der in variable Kosten und Fixe Kosten nötig.
3.1.1.1. New node
3.1.1.1.1. Variable Kosten sind Abhängig von der Laufzeit der Maschine, z.B. Energieverbräuche, Hilfsstoffe wie Öl, Schmiermittel, Rohstoffe
3.1.1.1.2. Fixe Kosten sind meist durch die reine Anwesenheit der Maschine verursacht, z.B. Grundkosten für Miete, Stromanschluss, Wartungsverträge
3.2. Kostenträgerrechnung (Mithilfe des Kostenträgerblattes BAB II)
3.2.1. Kostenträger sind die Einzelnen Produkte, die ein Unternehmen herstellt.
3.2.1.1. Screenshot 2024-10-05 165329.png
3.2.2. Ist-Kosten betrachten die Vergangenheit. Preisschwankungen und Beschäftigungsabweichungen können die errechneten Zuschlagssätze beeinflussen.
3.2.3. Ursachen der Kostenüberdeckung
3.2.3.1. 1) In der Fertigung Weniger Ausschuss produziert - geringere Produktionszeit, weil - Maschinen optimal genutzt (wirtschaftliche Losgrößenfertigung) - weniger Ausfall-/Stillstandszeiten aufgrund optimaler Wartung - weniger Energiekosten - geringerer Krankenstand (Leiharbeiter) - optimale Mitarbeiterschulungen - geringerer Verschleiß von Werkzeugen - Minderverbrauch von Betriebsstoffen - Niedrigere Rüstkosten - niedrigere Hilfslöhne - geringere Liegezeiten - geringere Stillstandszeiten => Reduzierung der Durchlaufzeit(en) (besteht aus: Rüstzeiten, Ausführungszeiten, Transportzeiten, Liegezeiten, Lagerzeiten) Negative Mieterhöhung Versicherungsprämien gesunken allg. Nebenkosten gestiegen 2) Materialbereich - günstigere Konditionen im Einkauf von Gemeinkostenmaterialien verhandelt - allgemeine Marktpreisbewegungen nach unten - geringerer Materialeinsatz (im Bereich Hilfs- und Betriebsstoffe) - neuer Lieferant von Gemeinkostenmaterialien - alternative Materialien verwendet - geringere Kosten in der Materialprüfung - optimale Lagerhaltung // Lagerhaltung optimiert (z.B. geringerer oder kein Schwund) - Umzug in eine günstigere Lagerhalle - weniger Kosten wegen geringerer Verderb-Quote
3.2.4. Ursachen der Kostenunterdeckung
3.2.4.1. In der Verwaltung: - Kostensteigerungen durch Abteilungserweiterung (neue MA oder auch „Jobenrichment“) - Fluktuation, d.h. Einarbeitung neuer MA - steigende Personalkosten (=Gehälter) – z.B. wegen tarifl. Erhöhung - Erhöhung der Abschreibung aufgrund Neuinvestitionen/Erweiterungsinvestition - Erhöhter Krankenstand- erhöhter Ausfall von Hardware - Einführung einer neuen Verwaltungssoftware - verlängerte Prozesse z.B. aufgrund gesetzlicher Neuregelungen DSGVO Mieterhöhung Erhöhung von Versicherungsprämien - Erhöhter Büromaterialverbrauch - mangelnde Motivation // Kommunikation // Innovationsbereitschaft Im Vertrieb: - Kostensteigerungen durch Abteilungserweiterung (neue MA) - steigende Personalkosten - neue Verpackungsrichtlinien ((- höhere Vertreterprovisionen)) - Höhere Provisionszahlungen an die Handelsvertreter - (Außerordentliche) zusätzliche Werbemaßnahmen - steigende Transportkosten (Maut, Sprit) - höhere Versandkosten aufgrund teurerem Verpackungmaterial - Fehlplanungen im Vertriebsmanagement - vermehrte Werbeaktivitäten // außergewöhnliche, einmalige Werbeaktion - Tag des offenen Betriebs (Kundenpräsente) - gestiegene Reklamationen – mehr Garantiefälle – persönliche Betreuung - gestiegene Versicherungsprämien
3.2.5. Folgen länger andauernder Kostenunterdeckung
3.2.5.1. -Gewinnschmälerung – schlimmstenfalls Verlust -EK-Verringerung -Liquiditätsprobleme (Rechnungen, Löhne Gehälter können nicht mehr pünktlich und in vollem Umfang bezahlt werden) -Bonität verschlechtert sich (größere Schwierigkeiten bei Kreditbeschaffung) Lösungsansatz: regelmäßige Wirtschaftlichkeitskontrollen durchführen Analysen, Vergleiche (Periodenvergleiche, Unternehmensvergleiche) Lean Production / LeanManagement => Kostenreduktion oder: Zuschlagsätze nach oben korrigieren / Preisanhebungen Frage? Ist das am Markt um- bzw. durchsetzbar???
3.3. Vorwärtskalkulation
3.3.1. Screenshot 2024-10-06 131930.png
3.3.1.1. Screenshot 2024-10-06 132326.png
3.3.1.1.1. Screenshot 2024-10-06 132352.png
3.3.1.2. Screenshot 2024-10-06 132453.png
3.3.1.2.1. Vom Hundert oder im Hundert? Bei der Vorwärtskalkulation wird bis zum Barverkaufspreis "vom Hundert" gerechnet, ab da "im Hundert". Der Gewinnzuschlag wird "vom Hundert" berechnet. Skonto, Vertreterprovision und Rabatt ziehen Kunden von "hinten" ab. Deshalb müssen Sie bei der Berechnung von Skonto, Vertreterprovision und Rabatt "im Hundert", d.h. mit vermindertem Grundwert rechnen. Der Zielverkaufspreis wird "im Hundert" berechnet. Der Listenverkaufspreis wird ebenfalls "im Hundert" berechnet.
3.3.1.2.2. Screenshot 2024-10-06 141419.png
3.4. Rückwärtskalkulation
3.4.1. Screenshot 2024-10-06 134120.png
3.4.1.1. Die Rückwärtskalkulation rechnet vom Verkaufspreis ausgehend stufenweise auf die Kosten für das Fertigungsmaterial zurück: Vom bekannten Verkaufspreis werden zunächst die kalkulatorischen Zuschläge bis zu den Selbstkosten herausgerechnet (vgl. obiges Beispiel). Anschließend wird mit den bekannten Zuschlagssätzen für Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten auf die Herstellkosten zurückgerechnet. Die Fertigungskosten werden mit ihren Daten (Eurobeträgen und Normalzuschlagssätzen) aus der Vorwärtskalkulation in die Rückwärtskalkulation übernommen. Um die Höhe der Materialkosten ermitteln zu können, werden nun die Fertigungskosten summiert, um diese dann von den Herstellkosten zu subtrahieren, Die auf diese Weise berechneten Materialkosten sind dann der Ausgangspunkt, um die Kosten für das Fertigungsmaterial zu bestimmen.
3.5. Allgemein
3.5.1. New node
3.5.1.1. Zu den Fertigungsgemeinkosten gehören Hilfslöhne, Gehälter für Meister und technische Angestellte, Kosten für Hilfsstoffe, Energiekosten, kalkulatorische Abschreibungen bzw. kalkulatorische Zinsen oder Betriebsmittelkosten des Fertigungsbereichs.
3.5.1.2. Materialgemeinkosten setzen sich v.a. zusammen aus: Löhnen, Gehältern und Personalnebenkosten der im Einkauf, im Lager und bei der Prüfung beschäftigten Personen, Abschreibungen und Instandsetzungen der Lagergebäude und -einrichtungen, Versicherungen der Lagergebäude und Bestände, Heizungs- und Beleuchtungskosten, ...
3.5.1.3. Beispiele für Vertriebsgemeinkosten sind die Gehälter der Angestellten, das Büromaterial oder die Kosten für Räumlichkeiten. Außerdem können dies Kosten für Werbung, Transport oder Marktforschung sein. Vertriebsgemeinkosten werden den Gemeinkosten zugeordnet und sind Bestandteile der Vollkostenrechnung.
3.5.1.4. Zu den Verwaltungsgemeinkosten gehören die Kosten für die Unternehmensleitung und Verwaltung des Unternehmens, z. B. Gehälter für den Vorstand und das Personal der Stabsstellen, Büromaterial oder Abschreibungen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung.
3.6. Kostenstellenrechnung
3.6.1. Sie ist erforderlich, um die Gemeinkosten nach einem in der Praxis gebräuchlichen Verfahren anteilig den Kostenträgern zurechnen zu können. Dies geschieht auf dem Umweg über die Kostenstellen.
3.6.1.1. New node
3.6.1.2. Aufteilung der Kosten
3.6.1.3. Kostenstellen nach Tätigkeit
3.6.1.4. Hilfskostenstellen
3.6.2. Betriebsabrechnungsbogen
3.6.2.1. Screenshot 2024-10-04 184733.png
3.6.2.2. Hierin werden die Gemeinkosten auf die jeweilige Kostenstelle (z.B. Material oder Fertigung) ermittelt.
3.6.2.3. Kosten aus der Betriebsrechnung BAB
3.6.2.4. Screenshot 2024-10-04 181714.png
3.6.2.4.1. Screenshot 2024-10-04 182238.png
3.6.2.5. HKDE / HKDU / Selbstkosten
3.6.2.5.1. Bestandsveränderungen beeinflussen also die Höhe der Herstellkosten: • Ist der Endbestand an unfertigen Erzeugnissen größer (kleiner) als der Anfangsbestand, hat sich der Bestand vermehrt (vermindert). Die Herstellkosten der Erzeugung sind größer (kleiner) als die Herstellkosten der fertigen Erzeugnisse. • Ist der Endbestand an fertigen Erzeugnissen größer (kleiner) als der Anfangsbestand, hat sich der Bestand vermehrt (vermindert). Die Herstellkosten der fertigen Erzeugnisse sind größer (kleiner) als die Herstellkosten des Umsatzes. • Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen können gegenläufig sein. Eine Bestandsminderung/-mehrung) an unfertigen Erzeugnissen kann einer Bestandsmehrung/-minderung) an fertigen Erzeugnissen gegenüberstehen. Sind die Werte der jeweiligen Bestandsveränderung nicht gleich groß, führt dies in der Summe entweder zu einer Bestandsmehrung oder zu einer Bestandsminderung der Erzeugnisse.
3.6.2.6. Merke
3.6.3. Stufenleiterverfahren
3.6.3.1. Es werden Hilfs- und Allgemeinekostenstellen eingerichtet. Die Kosten in diesen Kostenstellen (das können Abteilungen im Betrieb sein) werden verursachungsgerecht aufgeteilt. Die Allgemeinkostenstellen werden in der Regel auf alle Hauptkostenstellen aufgeteilt, die Hilfskostenstellen sind in der Regel vorbereitende Kostenstellen, die z.B. die Produktion unterstützen und werden diesen auch zugerechnet. Zur besseren Kostenkontrolle werden die Hauptkostenstellen in mehrere KST gegliedert (siehe Bild). So lassen sich bessere Analysen ziehen und evtl. Abweichungen im Zeitvergleich feststellen und Maßnahmen einleiten.
3.6.3.1.1. Stufenleiterverfahren
3.6.4. Anbauverfahren
3.6.4.1. Ist das einfachste Verfahren, hier werden die Kosten der Allgemeinkostenstellen direkt auf die HKST verteilt. Eine Verrechnung zwischen den AllgKST wird ignoriert! Es stellt ein sehr grobes Näherungsverfahren dar, und wird in der Folge auch kaum angewandt.
3.6.5. Bestandveränderungen
3.6.5.1. New node
3.6.5.2. Bei der Berechnung des HKDU für die VwVtGKZ werden Bestandveränderungen berücksichtigt. D.h. es wird Material aus dem Lager entnommen oder hinzugefügt.
3.6.5.2.1. Ein Minderbestand wird addiert (+), weil wir bereits produzierte Ware (MK I und FK II wurden ja bereits erbracht) aus dem Lager genommen haben und diese den Umsatzkosten hinzufügen müssen.
3.6.5.2.2. Ein Mehrbestand wird subtrahiert (-), weil er auf Lager gelegt wird und mit dem Umsatz somit nichts zu tun hat.
4. Grundlagen / Begriffe
4.1. Aufgaben KLR
4.1.1. New node
4.2. Unterschiede extern/intern Rewe
4.2.1. New node
4.3. Einzahlung
4.3.1. Einzahlungen sind Geschäftsfälle, die den Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel) erhöhen. So gehören Barverkäufe von fertigen Erzeugnissen zu den einzahlungswirksamen Vorgängen ebenso eine Kundenanzahlung durch Banküberweisung. Weitere Beispiele: • Barzahlungen bzw. Banküberweisungen von Kunden • Zahlungseingänge aus früheren Zielverkäufen • Privateinlagen des Unternehmers • Gutschriften von Kreditaufnahmen durch Kreditoren • Steuererstattungen
4.4. Auszahlung
4.4.1. Auszahlungen sind Geschäftsfälle, die den Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel) verringern. Zu den auszahlungswirksamen Vorgängen zählt z.B. eine Banküberweisung oder der Barkauf von Rohstoffen. Weitere Beispiele: • Privatentnahmen • Tilgung von Darlehen • Steuerzahlungen • Zahlungen von Versicherungsbeiträgen, Gebühren u.ä. • Barkauf von Sachgütern und Dienstleistungen • Bezahlung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4.5. Geldvermögen
4.5.1. Der Zahlungsmittelbestand ist Teil des Geldvermögens. Das Geldvermögen erfasst darüber hinaus die kurzfristig fälligen Forderungen (z.B. Forderungen aLL, Wertpapiere des UV) sowie die kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten (z.B. Verbindlichkeiten aLL, kurzfristige Rückstellungen).
4.5.1.1. New node
4.6. Einnahme
4.6.1. Wird das Geldvermögen durch Geschäftsfälle erhöht, so sprechen wir von Einnahmen. So gehören z.B. Bar- und Zielverkäufe von fertigen Erzeugnissen zu einnahmewirksamen Vorgängen. • Ein Barverkauf ist zugleich eine Einzahlung und eine Einnahme. Er erhöht den Zahlungsmittelbestand und damit zugleich das Geldvermögen. • Der Zielverkauf stellt eine Einnahme dar, ohne Einzahlung zu sein. Er erhöht die Forderungen aLL ohne den Zahlungsmittelbestand zu verändern. • Zahlt der Kunde durch Banküberweisung, so liegt eine Einzahlung aber keine Einnahme vor, da sich das Geldvermögen nicht ändert (der Zugang zum Bankguthaben wird ausgeglichen durch den Abgang von Forderungen aLL).
4.7. Ausgabe
4.7.1. Au Umgangssprachlich werden Ausgaben den Auszahlungen gleichgesetzt. In der Betriebswirtschaft und im Rechnungswesen wird dieser Begriff jedoch in einem streng definierten Sinn verwendet: Wird das Geldvermögen durch Geschäftsfälle vermindert, so liegt eine Ausgabe vor. • Ein Barkauf ist zugleich eine Ausgabe und eine Auszahlung. Er vermindert zugleich den Zahlungsmittelbestand und damit zugleich das Geldvermögen. • Der Zielkauf stellt eine Ausgabe dar, ohne Auszahlung zu sein. Er erhöht die Verbindlichkeiten aLL, ohne den Zahlungsmittelbestand zu verändern (Zahlung und Ausgabe fallen zeitlich auseinander). • Die Zahlung durch Banküberweisung an den Lieferanten bewirkt eine Auszahlung (=Verringerung des Zahlungsmittelbestandes) ohne zugleich eine Ausgabe zu sein (=das Geldvermögen ändert sich nicht; der Verminderung des Zahlungsmittelbestandes steht die Verringerung der Verbindlichkeiten aLL gegenüber).
4.7.1.1. New node
4.8. Aufwendung
4.8.1. • Das Unternehmen kauft Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe gegen Barzahlung. Die eingekauften Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe stellen bei aufwandsorientierter Buchung Werteverzehr im Produktionsprozess dar und werden als Aufwendungen für Roh-, Hilfs-bzw. Betriebsstoffe erfasst. Die mit dem Kauf verbundene Zahlung verringert die Zahlungsmittel und damit rechnerisch auch das Eigenkapital. • Auf einen betrieblich genutzten Pkw wird eine Abschreibung vorgenommen. Die Abschreibung stellt im Produktionsprozess einen Aufwand dar. Im Anlagevermögen wirkt sich die Abschreibung als Wertminderung aus. Sie verringert damit rechnerisch auch das Eigenkapital. • Das Unternehmen zahlt für einen aufgenommenen Kredit Zinsen. Die Zinsen stellen in der Gewinn- und Verlustrechnung Aufwendungen dar. Ihre Zahlung verringert den Zahlungsmittelbestand und damit rechnerisch das Eigenkapital.
4.8.1.1. New node
4.8.2. New node
4.9. Erträge
4.9.1. • Das Unternehmen verkauft fertige Erzeugnisse gegen Rechnung. Der Wert der verkauften Erzeugnisse wird in der Buchführung als Umsatzerlös (= Ertrag) gebucht. Der Zahlungsanspruch, den das Unternehmen gegenüber dem Kunden hat, erhöht die Forderungen und damit rechnerisch das Eigenkapital. • Das Unternehmen unterhält bei seiner Bank ein verzinstes Guthaben. Die Zinsgutschrift der Bank wird als Ertrag gebucht; sie erhöht zugleich den Zahlungsmittelbestand und damit rechnerisch das Eigenkapital.
4.10. Kosten
4.10.1. betriebliche Aufwendungen
4.10.1.1. Betriebliche Aufwendungen (= Kosten) stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem eigentlichen Betriebszweck. Sie erfassen die Werte der Güter, Dienste und Abgaben, die im Rahmen der geplanten betrieblichen Leistungserstellung (= Beschaffung und Produktion) und Leistungsverwertung (= Absatz) anfallen. Diese Aufwendungen werden in der Regel als Kosten in die Kosten- und Leistungsrechnung übernommen.
4.10.1.1.1. New node
4.10.2. neutrale Aufwendungen
4.10.2.1. Außer den Kosten gibt es im Industriebetrieb in der Regel auch Aufwendungen, die in keinem Zusammenhang mit der Beschaffung, der Produktion und dem Absatz stehen oder dabei unregelmäßig oder in außergewöhnlicher Höhe anfallen. Sie werden als neutrale Aufwendungen bezeichnet und nicht oder nicht in der angefallenen Höhe in die Kosten- und Leistungsrechnung übernommen, da sie bei der Ermittlung des Betriebsergebnisses und der Selbstkosten der Erzeugnisse nicht berücksichtigt werden dürfen.
4.10.2.1.1. Aufwendungen der FIBU
4.10.2.1.2. New node
4.10.3. Grundkosten
4.10.3.1. Stehen in Zusammenhang mit der FUBI, sind also Aufwendugnen aus der FIBU UND zugleich Kosten in der KLR. Z.b. Rohstoffaufwand, Personalaufwand
4.10.4. Anderskosten
4.10.4.1. Die Aufwendungen aus der FIBU werden mit einem anderen Betrag in die KLR übernommen, z.b. kalkulatorische Abschreibungen, kalkulatorische Zinsen
4.10.5. Zusatzkosten
4.10.5.1. Für Zusatzkosten gibt es keine Aufwendugn in der FIBU, z.B. kalkulatorischer Unternehmerlohn, kalkulatorische Miete (betrieblich unentgeltlich genutze Privaträume)
4.11. Leistungen
4.11.1. Merke
4.11.1.1. New node
4.11.2. betriebliche Erträge (Leistungen)
4.11.2.1. New node
4.11.2.2. Leistungen (=betriebliche Erträge) sind das Ergebnis der geplanten betrieblichen Leistungserstellung und -verwertung.
4.11.3. neutrale Erträge (Nichtleistungen)
4.11.3.1. New node
4.11.3.2. Neutrale Erträge sind in den Kontengruppen „54 Sonstige betriebliche Erträge“, „55/56 Erträge aus Beteiligungen und Wertpapieren“ und „57 Sonstige Zinsen“ enthalten.
5. Prozesskostenrechnung
5.1. Merke
5.1.1. lmi = Leistungsmengeninduziert (Je mehr Prozesse, desto hoher die Kosten, entspricht den Variblen Kosten).
5.1.1.1. Leicht zu errechnen, Kosten der Einheit durch Anzahl der Prozesse = Prozesskostensatz
5.1.2. lmn = leistungsmengenneutral (Das sind in der Regel Fixkosten, wie Gehalt der Abteilungsleitung)
5.1.2.1. Diese Kosten werden mit einem Schlüssel auf die anderen COST-Driver umgelegt (siehe FoSa)
5.1.3. Beispielrechnung
5.1.4. Kritik: Hier werden Fixkosten proportionalisiert - das ist genau das, was wir nicht wollten (vgl. starre PKR). Fehlentscheidungen bei Behandlung von Zusatzaufträgen ist unvermeidbar.
5.1.4.1. Vor- und Nachteile
5.2. Ziele der PKR
6. Plankostenrechnung
6.1. Grafik
6.2. Situation: Die Schmollmann GmbH plant die Herstellung von 100 Lagerrobotern in der nächsten Periode (meist 1 Jahr, Quartal oder Monat). Für die Herstellung der 100 Lagerroboter plant die Schmollmann GmbH mit Gesamtkosten (K) von 1.000.000 €. Daraus ergibt sich ein Stückpreis von 10.000 € je Lagerroboter. Diesen Stückpreis nennt man Plankostenverrechnungssatz (PKVS).
6.3. Die (blaue) Gerade zeigt den Verlauf der Kosten bei den unterschiedlichen Produktionsmengen, also z.B. bei 60 Stück würden 600.000 € Kosten entstehen. Sie stellt also die verrechneten Plankosten dar; an dieser Geraden kann man ablesen, wie viele der Stückkosten entsprechend dem Absatz verrechnet wurden. Damit ist generell ein Soll-IST-Vergleich möglich. Abweichungen von dieser Berechnung der Kosten können unvorhergesehene Ereignisse wie Absatzprobleme, erhöhter Materialverbrauch, Maschinenstillstand oder -schaden sein aber auch krankheitsbedingter Stillstand der Produktionsmaschinen. Die tatsächlichen IST-Kosten werden dann nach der Produktion (retrospektiv) ermittelt (z.B. Kostenträgerrechnung IST-Kostenrechnung) und stellen die Abweichungen zu den Plankosten dar.
6.4. Die Sollkosten stellen die Kosten dar, die schon aus der Kostenfunktion (FoSa Seite 26) bekannt sind. Hier wird der Teil der Fixkosten (Kf) als Basis angenommen und die von der Menge der produzierten Einheiten variablen Anteile addiert (x*kv). Die Gerade (Sollkosten) teilt die Gesamtabweichung in die Beschäftigungsabweichung und die Verbrauchsabweichung.
6.5. Die Verbrauchsabweichung beziffert die Ineffizienz in der Produktion. Diese ist durch Ausschuss, schlechte Qualität, Nacharbeit, unproduktive Arbeit, zu hoher Verbrauch, … verursacht worden! Diese Abweichungen wurden also in der Produktion verursacht und mit dieser Abweichung kann nun auf den verantwortlichen in der Produktion zugegangen werden und die Ursachen ermittelt werden.
6.5.1. positive VA
6.5.2. negative VA
6.6. Die Beschäftigungsabweichung stellt die Unterdeckung der Fixkosten dar. Die Kosten wurden ja auf 1000 Stück berechnet, insofern sind auch die Fixkosten darauf umgelegt worden.
6.6.1. positive BA
6.6.2. negative BA
6.7. Wie hoch der Anteil der variablen Kosten an den Gesamtkosten ist, gibt der Variator vor. Ein Variator von 0,6 entspricht einem variablen Anteil der Gesamtkosten von 60% (40% sind Fixkosten)
6.8. Wo setzt man die starre PKR ein? • Massenproduktion: In Betrieben mit stabilen Produktionsmengen, wie in der Automobil- oder Lebensmittelindustrie, wo die Produkte standardisiert sind, ist die starre Plankostenrechnung oft ausreichend. • Dienstleistungssektor: In Bereichen mit konstanten Dienstleistungen, wie in vielen Verwaltungs- oder Beratungsunternehmen, kann die starre Plankostenrechnung sinnvoll sein. • Öffentliche Verwaltung: Behörden und öffentliche Einrichtungen verwenden häufig starre Plankostenrechnungen, um Budgets zu planen und einzuhalten. • Bauwirtschaft: Bei großen Bauprojekten, die auf festen Verträgen basieren, kann eine starre Kostenplanung sinnvoll sein, um die Kosten zu kontrollieren. • Kleinere Unternehmen: In kleinen und mittelständischen Unternehmen, die nicht über die Ressourcen verfügen, um eine flexible Kostenrechnung zu implementieren, ist die starre Plankostenrechnung oft die praktikablere Wahl. • Industrien mit geringer Produktvielfalt: In Branchen, in denen Produkte wenig variieren und die Produktionsprozesse stabil sind, ist die starre Plankostenrechnung effizient.
6.9. New node
6.9.1. Leerkosten
6.9.2. Leerkosten
6.9.2.1. Mengenabweichung Preisabweichung
7. Controlling im Betrieb
7.1. Mit „Controlling“ ist im Wesentlichen das gemeint, was der englische Wortstamm „to control“ in der Übersetzung mit „steuern“ oder „regeln“ meint. Es geht um Kontrollen im Sinne von „Überprüfung des Istzustandes mit einem zuvor festgelegten Planzustand”. Der Controller hat im modern organisierten Unternehmen bildhaft gesprochen die Funktion eines Bergführers in einer Bergsteigergruppe: Er wird engagiert, weil er das Umfeld gut kennt; er wirkt bei der Festlegung der Ziele mit, arbeitet die optimale Route aus, begleitet die Gruppe, stellt Abweichungen vom Kurs fest und schlägt Kurskorrekturen vor; zur Not muss er dafür sorgen, dass die Expedition abgebrochen wird.
7.1.1. Controlling
7.2. PDCA
7.2.1. Stellung der Plankostenrechnung
7.2.1.1. Screenshot 2024-10-11 170905.png
8. Optimales Produktionsprogramm
8.1. Unter optimalem Produktionsprogramm versteht man die Ausrichtung der Produktion in einem Mehrproduktunternehmen auf die rentabelsten Erzeugnisgruppen, wobei sich die Rangfolge, in der die Erzeugnisse hergestellt werden, nach der Höhe der von ihnen erwirtschafteten absoluten oder relativen Deckungsbeiträge richtet.
8.1.1. Screenshot 2024-10-11 163357.png
8.1.2. Screenshot 2024-10-11 163820.png
9. Deckungsbeitragsrechnung
9.1. Grundlagen
9.1.1. Die Teilkostenrechnung ermöglicht marktorientierte Entscheidungen, weil nur die entscheidungsrelevanten Kosten berücksichtigt werden. Hierzu wird eine Kostenauflösung bezüglich des Verhaltens der Kosten bei Beschäftigungsschwankungen vorgenommen. D. h., es werden in der Teilkostenrechnung von den Umsatzerlösen der einzelnen Erzeugnisgruppen zunächst nur die auf sie entfallenden variablen Kosten abgezogen. Denn sie fallen für eine konkrete Unternehmensentscheidung kurzfristig zusätzlich an (z. B. Rohstoffkosten bei Annahme eines Zusatzauftrages).
9.1.1.1. Merke
9.1.1.2. Anwendung der Voll und Teilkostenrechnung
9.1.1.3. Variable Kosten und Fixkosten
9.1.1.3.1. proportionale variable Kosten (linear)
9.1.1.3.2. progressive variable Kosten
9.1.1.3.3. Fixkosten
9.1.1.3.4. Mischkosten
9.1.1.4. Kosten- und Umsatzfunktion
9.1.1.4.1. Break-Even / Deckungsbeitrag
9.2. Stückdeckungsbeitrag
9.2.1. Der Deckungsbeitrag je Stück (= db) trägt zur Deckung der ohnehin anfallenden fixen Kosten bei oder führt zu Betriebsgewinnen, sobald die fixen Kosten gedeckt sind. Allgemein gilt: Ein positiver Stückdeckungsbeitrag verbessert die Erfolgssituation.
9.2.1.1. Break Even
9.2.1.1.1. Merke
9.2.1.1.2. Formel
9.3. Mehrstufiger Deckungsbeitrag
9.3.1. Hier werden die Fixkosten verschiedener Produktionsstufen und den Abteilungen und des Betriebes berücksichtig um das Betriebsergebnis zu ermitteln
9.3.1.1. Mehrstufiger Deckungsbeitrag
10. Äquivalenzziffernkalkulation
10.1. Unterschiede in den Selbstkosten je Erzeugniseinheit können nur dadurch verursacht werden, dass die einzelnen Erzeugnisgruppen die Produktionsstätten verschieden stark beanspruchen. Das Kostenverhältnis, das die unterschiedlich starke Beanspruchung angibt, w ird durch Beobachtung und Messung festgestellt. Hierbei setzt man das Haupterzeugnis g leich 1 (also 100%) und bringt die anderen Erzeugnisgruppen durch einen die Kostenverursachung ausdrückenden Zuschlag oder Abschlag in Beziehung zu 1 (z.B. 0,8 bei Erzeugnis B und 1,2 bei Erzeugnis C). Die sich ergebenden Zahlen heißen Äquivalenzziffern. Voraussetzungen für die Anwendung der Äquivalenzziffernrechnung: • Die Erzeugnisse müssen artgleich sein, z. B. Ziegel, Biersorten, Bausteine, Zigaretten usw. • Die Erzeugnisse müssen in einem festen Kostenverhältnis zueinander stehen.
10.1.1. Berechnung
10.1.2. Merke
11. Maschinenstundensatz
11.1. Grundlagen / Begründung MSS
11.1.1. Fertigungsgemeinkosten
11.1.1.1. Maschinenabhängige Gemeinkosten
11.1.1.2. Mehr- Minderauslastung der Maschine
12. Divisionskalkulation
12.1. Die einfache Divisionskalkulation ist anwendbar, wenn ein Unternehmen nur eine Erzeugnisart herstellt (z. B. Elektrizitätswerk, Ziegelei, Brauerei usw.). Die Selbstkosten für den einzelnen Kostenträger ergeben sich aus der Division der Gesamtkosten einer Abrechnungsperiode durch die Produktionsmenge der gleichen Periode.
12.1.1. Einfache Div-Kalk
12.1.2. Screenshot 2024-10-07 080834.png
