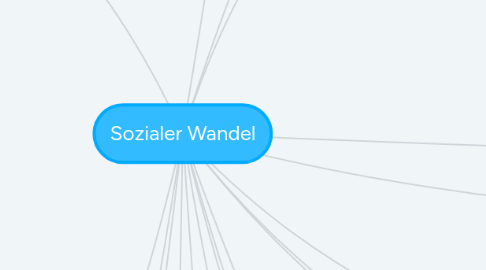
1. Leistungsfähigkeit bemisst sich an Bildung
1.1. neue Konzepte
1.2. Modernisierung -> digital
1.3. Förderungsangebote
1.4. mehr Lehrkräfte
1.5. finanzielle Mittel benötigt
2. Bedingungsloses Grundeinkommen
2.1. jeder bekommt bedingungslos jeden Monat einen bestimmten Betrag überwiesen
2.2. Finanziert entweder durch Mehrwertsteuer (Mittelschicht) oder Einkommensteuer (reiche Schicht)
2.3. Ersetzt Sozialgelder, Kindergeld, etc.
2.4. Pro
2.4.1. Es ist bedingungslos (keine Bürokratie, Datenstriptease und Wartezeit)
2.4.2. Freiheit -> eigene Aufteilung
2.4.3. Absicherung für z.B. Studenten
2.4.4. Soziales Prinzip -> wer mehr verdient kann es sich auch leisten mehr einzubringen
2.4.4.1. Schere zwischen arm und reich würde sich verringern
2.4.5. Freiheit auch eher finanziell unattraktive Berufe auszuüben -> mehr wagen
2.4.6. Mehr Geld im Umlauf -> Ankurblung der Wirtschaft
2.4.7. Familiengründung attraktiver
2.4.8. mehr Verantwortung für eigenes Handeln
2.5. Contra
2.5.1. Kann jeder das Geld richtig ausgeben?
2.5.2. Langfristiges Planen und Investieren nötig -> Altersarmut!?
2.5.3. Sorge: gehen die Menschen dann noch arbeiten?
2.5.4. Mehr Abzüge bzw. kein Sozialversicherungssystem!?
2.5.5. Besserverdiener zahlen mehr -> Abwanderung!?
2.5.6. Wegfall von "schlechten" (unattraktiven) Jobs
2.5.7. Leistungsbereitschaft ggf. gesenkt
2.5.8. je nach Finanzierung hauptsächlich für Mittelschicht und Ärmere spürbar (Mehrwertsteuer)
3. Fachkräftemangel
3.1. Folge demografischer Wandel
4. Prinzipien eines Sozialstaats
4.1. Versicherungspflicht
4.1.1. Pflicht gegen Risiken versichert zu sein
4.1.2. Ausnahmen sind möglich
4.1.2.1. Selbstständige
4.1.2.2. Freiberufler
4.1.2.3. geringfügig Beschäftigte
4.1.2.4. Beamte
4.1.2.5. Soldaten
4.2. Solidaritätsprinzip
4.2.1. Unabhängig von der Inanspruchnahme, alle Versicherten zahlen ein
4.2.1.1. diejenigen, die mehr in Anspruch nehmen, werden durch andere abgesichert
4.2.2. Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen Beiträge in Sozialversicherungssysteme
4.2.3. Beiträge richten sich Einkommen
4.3. Leistungen durch solidarischen Ausgleich verteilt
4.4. Versortgungsprinzip
4.4.1. Aus Ausgaben an Fiskus leistet Sozialstaat Entschädigung für erlittene Nachteile, Schäden oder Opfer
4.4.1.1. Fiskus = der Staat als Eigentümer des öffentlichen Vermögens/Staatskasse
4.4.1.2. Ausgleich für "Schicksalsschläge"
4.4.1.2.1. Betroffene sollen nicht allein gelassen werden
4.5. Subsidiaritätsprinzip
4.5.1. individuelle Not lindern
4.5.1.1. Individuell > Familiär > Lokal > Staatlich
4.6. Alimentationsprinzip
4.6.1. besonderer Schutz für kleinere Gruppen
4.6.2. bessere Vorsorge und Grundsicherung abseits anderer Versicherungssysteme
4.6.2.1. Beamtenversorgung
4.6.2.2. Absicherung der Landwirte
4.6.2.3. Unterstützung von Studierenden und Schülern mittels BAföG
5. Das deutsche Sozialversicherungssystem
5.1. Ursprung Otto von Bismarck
5.2. Rentenversicherung
5.2.1. Träger: Versicherungsanstalt
5.2.2. Leistungen: Altersrente, Hinterbliebenenrente und Erwerbsminderungsrente
5.3. Beiträge: 18,6% (50/50 - AN & AG) (9,3%)
5.4. Krankenversicherung
5.4.1. Träger: Krankenkassen
5.4.2. Leistungen: Krankenhilfe, Krankengeld, Rehabilitationsmaßnahmen, Mutterschaftsgeld, Arztbesuche, Krankenhausaufenthalts und Haushaltshilfe
5.4.3. Beiträge: 14,6% + x (50/50 AN & AG) (7,3%)
5.4.4. Träger: Bundesagentur für Arbeit
5.5. Arbeitslosenversicherung (16. Juli 1927)
5.5.1. Leistungen: Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Arbeitsvermittlung, Förderungsmaßnahmen, Fortbildung, Umschulung und Wiedereingliederung
5.5.2. Beiträge: 2,4% (50/50 AN & AG) (1,2%)
5.6. Pflegeversicherung (1. Januar 1995)
5.6.1. Träger: Pflegekassen der Krankenkasse
5.6.2. Leistungen: Geldleistungen und Sachleistungen
5.6.3. Beiträge: 3,05% (50/50 AN & AG) (1,525%)
5.7. Unfallversicherung
5.7.1. Träger: Berufsgenossenschaften
5.7.2. Leistungen: Sterbegeld, Heilbehandlung, entfall und Renten
5.7.3. Beiträge: AG je nach Unfallgefahr
6. Arbeitsmarkt
6.1. Mangel an Pflegepersonal
7. Stress
7.1. schlecht bezahlte Berufe
7.1.1. Armut im Verhältnis zum jeweiligen gesellschaftlichen Umfeld
7.2. Herzkrankheiten
8. viele junge Menschen
8.1. gesünderer Lebensstil
9. kein Zustand, sondern ein dynamischer Prozess
10. Armut
11. Demografie -> Beschreibung der Bevölkerungsstruktur
12. Unfähigkeit, menschliche Grundbedürfnisse zu befriedigen
12.1. Ausübung von Recht
12.2. Sicherheit und Würde (menschenwürdige Arbeit)
13. Konsum
14. absolute Armut
14.1. voraussichtlich Alterspyramide gedreht
14.2. unfähig eigene wirtschaftliche und soziale Grundbedürfnisse zu befriedigen
14.2.1. Lebenserwartung bis 100
14.2.1.1. Sicherung von Nahrungsmitteln, Gesundheitsversorgung und Bildung
15. alleinerziehende Elternteile
15.1. Kind zuhause -> wenig Zeit und nicht flexibel
16. Armut
16.1. Arten von Armut
16.1.1. relative Armut
16.1.2. Altersarmut
16.1.2.1. zu wenig Rente
16.1.2.1.1. früherer Tod
16.1.2.2. Selbstmord Gefahr
16.2. schlechtere Versorgung
16.3. Gründe
16.3.1. Arbeitslosigkeit
16.3.1.1. Psychische Belastung
16.3.2. geringe Bildung
16.3.2.1. Beispiel
16.3.2.1.1. können nicht mitmachen bei Dingen, die für andere selbstverständlich sind
16.4. Folgen
17. Demografischer Wandel
17.1. Demografischer Wandel -> beschreibt Veränderung der Bevölkerungsstruktur
17.2. neue Verhütungsmittel, insbesondere die Pille
17.3. Ungleichgewicht
17.3.1. niedrige Geburten- und Sterberate
17.3.1.1. erst auf Karriere aus -> Mann sowie Frau
17.3.1.2. Kinder bedeuten enorme Kosten
17.3.1.3. bessere medizinische Versorgung
17.3.1.4. bessere Arbeitsbedingungen
17.4. Generationsvertrag
17.4.1. Rentenversicherung
17.4.2. stillschweigende Vereinbarung -> jeder deutsche Bürger geht automatisch Vertrag ein
17.4.2.1. neue Genration sorgt für die alte Generation
17.4.2.1.1. immer weniger junge Menschen müssen für immer mehr ältere Menschen aufkommen
17.4.2.2. weniger alte Menschen
17.5. mehr mittelalte bis alte Menschen
17.5.1. Resultat aus demografischen Wandel und Generationsvertrag
17.6. Alterspyramide
17.6.1. 1950
17.6.2. 2000
17.6.3. 2050
18. Lösungsansätze
18.1. Fachkräftemangel
18.1.1. spätere Rente
18.1.2. Personal aus dem Ausland
18.2. Mangel an Pflegepersonal
18.2.1. Zugang erleichtern
18.2.2. Personal aus dem Ausland
18.2.3. bessere Anreize und Arbeitsbedingungen
18.3. Generationsvertrag
18.3.1. höhere Beiträge
18.3.2. spätere Rente
