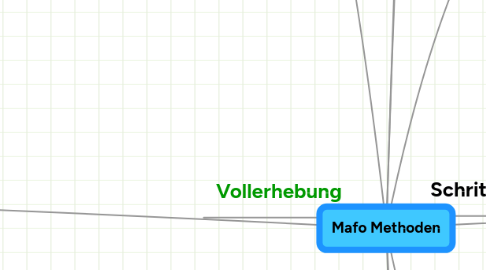
1. Erhebung von Sekundärdaten (Desk-Research)
1.1. Interne Daten
1.2. externe Daten
1.2.1. kommerziell
1.2.2. publiziert
2. Vollerhebung
3. Teilerhebung
3.1. willkürliche Auswahl
3.2. Repräsentative Auswahl
3.2.1. Bewusste Auswahl
3.2.1.1. Verfahren
3.2.1.1.1. Konzentrationsverfahren (cut-off)
3.2.1.1.2. Typische Auswahl
3.2.1.1.3. Quota-Verfahren
3.2.1.2. Kriterien
3.2.1.2.1. Konstruktion nach sachrelevanten Merkmalen
3.2.1.2.2. Stichprobenfehler nicht berechenbar
3.2.1.2.3. Repräsentative Abbildung der GG in Stichprobe
3.2.2. Zufallsauswahl
3.2.2.1. Verfahren
3.2.2.1.1. Einfache Zufallsauswahl
3.2.2.1.2. Geschichtete Zufallsauswahl
3.2.2.1.3. Klumpenauswahl (Cluster)
3.2.2.2. Kriterien
3.2.2.2.1. Zufallsmechanismen
3.2.2.2.2. Stichprobenfehler berechenbar
3.2.2.2.3. Angleich an Vollerhebung mit wachsender Stichprobengröße
3.2.3. Besondere Verfahren
3.2.3.1. Verfahren
3.2.3.1.1. reine mehrstufige
3.2.3.1.2. kombinierte mehrstufige
3.2.3.1.3. Random-Route
3.2.3.1.4. mehrstufig geschichtet mittels Musterstichprobenplänen
3.2.3.2. Kriterien
3.2.3.2.1. mehrstufig oder kombiniert
3.2.3.2.2. Kombination / Erweiterung der Standardauswahl
4. Ad-Hoc-Forschung
4.1. Verfahren
4.1.1. Befragung
4.1.1.1. Untersuchungsthemen
4.1.1.1.1. Spezialbefragung
4.1.1.1.2. Omnibusbefragung
4.1.1.2. Erhebungsform
4.1.1.2.1. schriftliche Befragung
4.1.1.2.2. persönliche Befragung
4.1.1.2.3. telefonische Befragung
4.1.1.2.4. computergestützte Befragung
4.1.1.3. Adressatenkreis
4.1.1.3.1. Experten
4.1.1.3.2. Händler
4.1.1.3.3. Kunden
4.1.1.4. Befragungstaktik
4.1.1.4.1. direkt
4.1.1.4.2. indirekt
4.1.1.5. Befragungsstrategie
4.1.1.5.1. standardisiert
4.1.1.5.2. nichtstandardisiert
4.1.1.5.3. geeignete Frageformen
4.1.1.5.4. ungeeignete Frageformen
4.1.1.5.5. offene Fragen
4.1.1.5.6. geschlossene Fragen
4.1.1.5.7. Fragebogengestaltung
4.1.2. Beobachtung
4.1.2.1. Kriterien
4.1.2.1.1. grundlegende Methode der Primärforschung
4.1.2.1.2. Partizipationsgrad der Beobachter
4.1.2.1.3. Ort der Beobachtung
4.1.2.1.4. Sonderformen wie Selbst oder Registrierung
4.1.2.2. Arten
4.1.2.2.1. Offene Beobachtung
4.1.2.2.2. Biotische Beobachtung
4.1.2.3. Einsatzbereich
4.1.2.3.1. Kundenlaufstudien
4.1.2.3.2. Einkaufsverhaltens / Kundenreaktionsstudien
4.1.2.3.3. Handhabung
4.1.2.3.4. Mitarbeiter im Verkauf
4.1.2.3.5. Besucher
4.1.2.3.6. Konkurrenz
4.1.2.3.7. Registrierung
4.1.2.3.8. Laborbeobachtung
4.1.2.4. Vorteil
4.1.2.4.1. Auskunftsbereitschat nicht notwendig
4.1.2.4.2. Testperson ist Erhebung nicht bewusst
4.1.2.4.3. keine Ergebnisverzerrung (biotische Situation)
4.1.2.5. Nachteil
4.1.2.5.1. Interpretation
4.1.2.5.2. Kapazität des Beobachters
4.1.2.5.3. Repräsentanzprobleme
4.1.2.5.4. Beobachtereinfluss
4.1.2.5.5. Beobachtungseffekt (offene Situation)
4.1.2.6. Klausur
4.1.2.6.1. Welche Beob.-Form? Biom./Offen? + Vor/Nachteile + Begündung
4.1.3. Exploration
4.1.3.1. Kriterien
4.1.3.1.1. pers. mündl. Befragung
4.1.3.1.2. Fragenablauf nur grob gegeben
4.1.3.1.3. frei, zwanglos
4.1.3.2. Einsatzbereich
4.1.3.2.1. aufbau Vertrauen
4.1.3.2.2. schwierige Themen
4.1.3.2.3. Motiv- & Einstellungsstudien
4.1.3.2.4. Pilotstudien
4.1.3.3. Vorteil
4.1.3.3.1. Anpassung Interviewer an P
4.1.3.3.2. ganzheitliche ANsprache
4.1.3.3.3. tiefgehende Infos
4.1.3.4. Nachteil
4.1.3.4.1. nur qualitativ
4.1.3.4.2. teuer
4.1.3.4.3. unrepräsentativ
4.1.3.4.4. gutes Personal nötig
4.1.3.4.5. Auswertung schwer
4.1.3.4.6. Interviewereinfluss
4.1.4. Gruppendiskussion
4.1.4.1. Kriterien
4.1.4.1.1. Wortdynamik
4.1.4.1.2. Diskussion unter Moderation
4.1.4.1.3. schwach strukturierter Themenkatalog
4.1.4.1.4. Protokollierung audiovisuell
4.1.4.1.5. Gruppeninterview oder Gruppenworkshop
4.1.4.2. Einsatzbereich
4.1.4.2.1. unangenehme Themen
4.1.4.2.2. Produktkonzepttests
4.1.4.2.3. Werbetests
4.1.4.2.4. Imagestudien
4.1.4.2.5. Vorstufe zu repräsentativen, qual und quan Erhebungen
4.1.4.3. Vorteil
4.1.4.3.1. Breites Spektrum an Meinungen, Ideen
4.1.4.3.2. Interaktion senkt Hemmungen der TN
4.1.4.3.3. Beobachtbare Reaktionen
4.1.4.3.4. Widerholbarkeit
4.1.4.3.5. Schnelligkeit
4.1.4.4. Nachteil
4.1.4.4.1. Moderator dominant
4.1.4.4.2. Gruppendyn. Kontrollmechanismus
4.1.4.4.3. qualitiativ
4.1.4.4.4. unrepräsentativ
4.1.4.4.5. Interpretation
4.1.4.4.6. oberflächliche Auswertung
4.2. Kennzeichen
4.2.1. Primärforschung
4.2.2. Einmaligkeit des Erhebungsintervalls
4.2.3. zeitpunktbezogen
4.3. Problematik
4.3.1. Befragungsmüdigkeit
4.3.2. Auskungtsverweigerung
4.3.3. Validität
5. Erhebung von Primärdaten (Field-Research)
5.1. Befragung
5.1.1. Quantitativ
5.1.1.1. Standardisiertes mündl. Interviews
5.1.1.2. Telefoninterview
5.1.1.3. schriftl. Befragung
5.1.1.4. Computergestützte Befragung
5.1.2. Qualitativ
5.1.2.1. Gruppendiskussion
5.1.2.2. Qualitatives Intervies
5.2. Beobachtung
5.3. Mischformen
5.3.1. Experiment
5.3.1.1. Laborexperiment
5.3.1.2. Feldexperiment
5.3.2. Panelforschung
5.3.2.1. Verbraucherpanel
5.3.2.2. Handelspanel
6. Skalierung
6.1. Skalenniveaus
6.1.1. Verhältnisskala
6.1.2. Ordinalskala
6.1.3. Nominakskala
6.2. Verfahren
6.2.1. Selbsteinstufung
6.2.1.1. Einfache Ratingskala
6.2.1.1.1. P geben Position in Skala selbst an
6.2.1.1.2. 4-7 Stufen
6.2.1.1.3. intervall-skaliert
6.2.1.1.4. Vorteil: einfache Handhabung
6.2.1.1.5. Nachteil: Tendenz zu Mitte oder Extrem
6.2.2. Fremdeinstufung
6.2.2.1. Subjektive Fremdeinstufung
6.2.2.1.1. Verfahren der Indexbildung
6.2.2.2. Objektive Fremdeinstufung
6.2.2.2.1. Eindimensionale Skalierung
6.2.2.2.2. Mehrdimensionale Skalierung
7. Schritte
7.1. Exploraion
7.2. Deskription
7.3. Erklärung
7.4. Prognose
8. bis s. 45 in zusammenfassung
9. Tracking-Forschung
9.1. Kennzeichen
9.1.1. Spezielle Form der Primärforschung
9.1.2. keine eigene Methode
9.1.3. Regelmäßige Erhebungen
9.1.3.1. Wellenerhebung
9.1.3.1.1. gleiches Thema
9.1.3.1.2. gleiche Stichprobe
9.1.3.2. Panelerhebung
9.1.3.2.1. gleiches Thema
9.1.3.2.2. identische Stichprobe
9.1.3.2.3. Arten
9.1.3.2.4. Probleme
10. Marktsegmentierung
10.1. Def
10.1.1. Zerlegung des Marktes in Teilmärkte
10.1.2. intern homogen, extern heterogen
10.2. Segmente werden ausgewählt & als ZG bearbeitet
10.3. Probleme
10.3.1. Informationsaspekt
10.3.2. Entscheidungsaspekt
10.3.3. Aktionsaspekt
10.4. Ziel
10.4.1. Marktidentifizierung
10.4.1.1. rel. Gesamtmarkt abgrenzen
10.4.1.2. rel. Teilmarkt bestimmen
10.4.1.3. Marktlücken finden
10.4.2. Effektiver Einsatz der Marketinginstrumente
10.4.2.1. Kundenbedürfnisse
10.4.2.2. Zielerreichungsgrade
10.4.2.3. Wettbewerbsvorteile
10.4.3. Prägnante Positionierung
10.4.3.1. Neuprodukte
10.4.3.2. Prazisierung von ZG
10.4.3.3. Vermeidung von Substitution im eigenen Sortiment
10.4.4. Prognosen Marktentwicklung
10.5. Kriterien
10.5.1. Messbarkeit
10.5.2. Substantialität
10.5.2.1. Zusammenhang Segment/Kaufverhalten
10.5.2.2. Umsatzpotential
10.5.3. Erreichbarkeit
10.5.4. Trennbarkeit
10.5.5. Machbarkeit
10.6. Klassifikation
10.6.1. Geografisch
10.6.2. Demografisch
10.6.2.1. Sozio-Geo
10.6.2.1.1. Nielsen
10.6.2.2. Sozio-Öko
10.6.2.2.1. Einkommen, HH-Größe, Ausbildung
10.6.2.3. Sozio-Demo
10.6.2.3.1. Alter, Geschlecht, ...
10.6.3. Psychografisch
10.6.3.1. Persönlichkeitsmerkmale
10.7. Prozess
10.7.1. Daten über Gesamtmarkt
10.7.2. Auswahl rel. Segmentierungskriterien
10.7.3. Mehrere Kriterien hintereinander
10.7.4. Konkrete Beschreibung der ZG-Segmente
