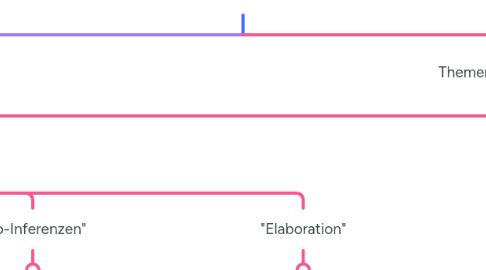
1. Die Beanspruchung durch den Lernprozess (Germane Load) umfasst die Elaboration und Kompilierung von Informationen im Arbeitsgedächtnis, um Schemata zu bilden und zu automatisieren, was gezielte mentale Anstrengung, aktive Lernstrategien und metakognitive Prozesse erfordert (Kerres, 2024, 189f.)
2. Didaktische Struktur Kooperativen Lernens (Schaumburg/Prasse, Medien und Schule, 2019) LW
3. Themenstellung
3.1. Aufgabenstellung 1
3.1.1. "Kooperatives Lernen" / "Interaktives Lernen"
3.1.1.1. Definition
3.1.1.1.1. Kooperatives Lernen beschreibt eine Form des Lernens, bei der Lernende durch Zusammenarbeit innerhalb von Gruppen aktiv in den Lernprozess eingebunden werden.
3.1.1.2. Potenziale für das fachliche Lernen
3.1.1.2.1. Tiefere Verarbeitung der Inhalte und Aufbau neuer Wissensstrukturen (Kollar & Fischer)
3.1.1.2.2. Notwendigkeit einer didaktischen Struktur (Johnson, 1999, und Slavin 1980, genannt in Prasse/Schaumburg, Medien und Schule 2019, S. 199) LW
3.1.1.3. Belege aus der Lehr- und Lernforschung
3.1.1.3.1. Kooperatives Lernen verbessert nicht nur die Fähigkeit zur Problemlösung, sondern führt auch zu einer besseren langfristigen Behaltensleistung (Slavin, 2015)
3.1.1.3.2. Vorteile kooperativen Lernens in Zierer, Lernen 4.0, 2020 LW
3.1.2. "Co-Inferenzen"
3.1.2.1. Definition
3.1.2.1.1. Co-Inferenzen beschreiben kognitive Prozesse, die durch die Auseinandersetzung mit den Beiträgen anderer Lernender entstehen. Sie umfassen sowohl Nachdenken oder Reagieren auf Argumente, wodurch Lernende zu einer tieferen Elaboration und Integration des Lernstoffs angeregt werden (Kollar & Fischer, 2019)
3.1.3. "Elaboration"
3.1.3.1. Elaboration beschreibt den kognitiven Prozess, bei dem Lernende neues Wissen aktiv mit bestehendem Vorwissen verknüpfen und so tiefergehende Verstehensprozesse anregen. Dieser Prozess ist ein zentraler Mechanismus des Lernens und der Wissenskonstruktion (Chi & Wylie, 2014)
3.1.3.1.1. Informationen im Arbeitsgedächtnis werden durch Verarbeitungsprozesse und Elaboration mit vorhandenen Schemata im Langzeitgedächtnis verknüpft, wodurch Lernen als Erweiterung oder Veränderung dieser Schemata gelingt. (Kerres, 2024, 187)
3.2. Aufgabenstellung 2
3.2.1. Die Rolle der digitalen Medien im Hinblick auf kooperatives Lernen
3.2.1.1. Digitale Medien spielen beim kooperativen Lernen eine zunehmend wichtige Rolle, da sie die Kommunikation und Kollaboration über räumliche und zeitliche Grenzen hinweg erleichtern können (Kerres, 2018)
3.2.1.1.1. Digitale Medien können Lernende in zeitlich und räumlich flexiblen Lernumgebungen vernetzen, wodurch asynchrone und synchrone Interaktionen erleichtert werden (Kerres, 2018)
3.2.2. Herausforderungen/ Lösungen
3.2.2.1. Kognitive Überlastung und Missverständnisse. Fokus auf bereits bekannte Informationen statt Austausch neuer Informationen (Stasser & Titus, 1985). Hoher Koordinationsaufwand. Risiko des sozialen Faulenzens, bei dem einzelne Mitglieder Aufgaben an andere delegieren (Salomon & Globerson, 1989).
3.2.2.1.1. Unter Group-Awareness versteht man die Informationen, die Gruppenmitglieder über Aspekte einer Gruppe oder der übrigen Gruppenmitgliederhaben, z.B. deren Aufenthaltsort, Aktivitäten, Emotionen, Interessen oder Wissen(Bodemer, Janssen& Schnaubert2018, S. 351). Ein Group-Awareness-Tool ist ein Software-Tool, das Informationen über Aspekte einer Gruppe oder der übrigen Gruppenmitglieder bereitstellt, die für kooperatives Lernen relevant sind (vgl. Bodemer et al. 2018; Janssen& Bodemer2013).
3.2.3. Konkrete Beispiele
3.2.3.1. Nutzung von Videokonferenzsystemen (z.B. Visavid, Teams, Zoom, usw.) zur Interaktion in Echtzeit --> soziale Präsenz ist ein Schlüsselfaktor für die Motivation und den Erfolg im interaktiven Lernen (Kerres, 2018)
3.2.3.1.1. Bereitstellung von Foren und Lernplattformen (z.B. Mebis, Moodle) für reflektierte Diskussionen
3.2.3.1.2. Apps/ Programme
