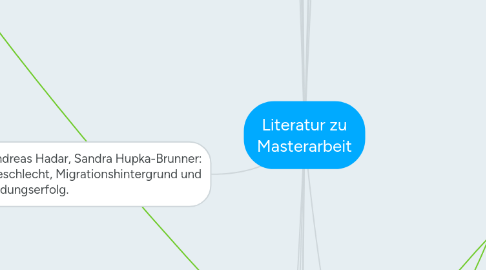
1. s. 28: Das marxsche Gesetz der kapitalistischen Akkumulation vs. Der Abbau von Klassengegensätzen durch Erhöhung der Einkommens- Sozial- und Bildungsstandards
1.1. Bourdieu's neue KLassenanalyse: Zwei Seiten des selben widersprüchlichen Entwicklungsprozesses.
1.1.1. s. 29: Das mehrdimensionale Konzept des sozialen Raums
1.1.1.1. s. 34: - Bildung wurde zum Kampfgegenstand zwischen den sozialen Milieus. - Die Ungleichheit der (Bildungs)leistungen ist nicht chancengleich, sondern ist durch die Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen bedingt.
1.1.1.2. s. 37: Rational Choice ist nicht verallgemeinerbar.
1.1.1.3. s. 37: Das Konzept des Habitus lässt das ganze Spektrum verschiedener Strategien sozialer Positionssicherung ermitteln. (-> Reproduktions- und UMstellungsstrategien)
1.1.1.4. s.37: Der scheinbare soziale Auftsieg durch Bildung ist eine blosse Verschiebung auf der horizontalen Achse in Bourdieus Modell.
1.1.1.5. s. 39: Die Bedeutung der Bildung für die fünf Traditionslinien der Milieus
1.1.1.5.1. Milieus von macht und BEsitz: Bildung mit Ziel der exklusiven Statussicherung. Nicht Leistung, sondern Abgrenzung zu den anderen Milieus stehen im Vordergrund. (=Distinktive, hochkulturelle Selbstverwirklichung).
1.1.1.5.2. Milieu linke Mitte: Leistungs- und Bildungsethik soll Autonomiegewinn bringen.
1.1.1.5.3. kleinbürgerliche Mitte: Bildung als Eindordnung in die ständischen Hierarchien
1.1.1.5.4. Milieus der Unterprivilegierten: Bildung symbolisiert dass MIthalten mit der 'respektablen' übrigen Gesellschaft.
1.1.1.5.5. 5. nix defniniert...
2. s. Engler & B. Krais - Das kulturelle Kapital und die Macht der Klassenstrukturen. Sozialstrukturelle Verschiebungen und Wandlungsprozesse des Habitus. Bildungssoziologische Beiträge.
2.1. s. 13: Die Bildungsexpansion ist eine Illusion
2.1.1. Vor allem Kinder der höheren Bildungs- und Besitzmilieus haben ihre Beteiligung an Gymnasial und Hochschulbildung mehr als verdoppelt.
2.1.2. VOn den Unterschichten werden viele von denen, die trotzdem eine Mittel- und Hochschulkarriere anstreben auf ihrem Weg nach und nach abgedrängt --> Komplexes System von Sortierungen
2.1.3. s. 16f: - Bildung und Beschäftigung wurden nicht voneinander entkoppelt. (siehe auch s. 23f) -Die soziale UNgleichheit hat sich nicht abgebaut. - Die Zuweisung sozialer Stellungen blieb ausserordentlich stabil. Verletzung des meritokratischen Prinzips.
2.1.4. s. 27: Bourdieus Habitus: Die spezifischen Strategien, mit denen die verschiedenen sozialen Klassen und deren Teilfraktionen ihre soziale Stellung zu erhalten oder zu verbessern erstreben.
2.2. s.98: Die Bedeutung der Bildungsexpansion für sozial schwache Milieus ist aus drei Perspektiven betrachtbar:
2.2.1. Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und dem Bildungserfolg (Persistenz und Veränderung der intergenerationalen vererbung von kulturellem Kapital.
2.2.2. Sozialisationsprozesse und Habitusformen
2.2.3. Persistenz und Veränderung der institutionellen Strukturen.
2.2.3.1. s. 111: "The social distance between educational groups has narrowed toward the top, but has widened toward the bottom". DAs Bildungssystem liest negativ aus.
2.3. s. 116: Bourdieu hat keine Analyse schulischer KOmmunikationsprozesse vorgenommen.
2.3.1. Die INstitution Schule als Black Box: Nicht die internen Prozesse sind für Bourdieu von belang, sondern rein der Outpu wie etwa Schulktitel.
2.3.2. s. 125:Innerschulische Studien haben gemeinsame Aspekte
2.3.2.1. Hervorbringungsannahme: SOziale Wirklichkeit ist nicht einfach vorhanden, sondern wird durch die Akteure durch ihr Wissen und ihre Praktiken interaktiv hervorgebracht.
2.3.2.2. Darstellungsannahme: Akteure (SuS und LP etc.) bringen ihr Wissen in ihren Praktiken zur Darstellung, deshalb ist dsa Wissen beobachtbar.
2.3.2.3. s. 19: Der Begriff der Abdrängung (nach Bourdieu): Individuen aus tieferen sozialen Schichten haben zwar Zugang zur höheren Bildung, lassen sich aber innerhalb dieser in Fächer von geringerem Wert abdrängen. --> Segregation.
2.3.2.4. Lokalitätsannahme: Spezifische Lokalitäten formen den Handlungsrahmen. In ihnen sind das Wissen und die Praktiken eingebettet.
2.3.2.5. Symmetrieannahme: gute und schlechte SuS sind jeweils Kategorien von Akteuren. Die Perspektive hierbei ist symmetrisch und das Recht dazu ist zu diskutieren.
2.3.3. s. 133: Die Unterschiede zwischen Bourdieu und modernerer Forschung
2.3.3.1. 1. Statistsische Sozialforschung (Bourdieu) vs. qualitative Sozialforschung (neue Bildungsforschung).
2.3.3.2. 2. Habitusformen, Kapitalkonversionen oder Transversalverlagerungen ins sozialen Räumen gehen an den Problemstellungen der neuen Forschung vorbei. Diese bezieht sich auf den Fokus auf Praktiken udn Wissen(sgenerierung).
2.3.3.3. 3. Die neue Bildungforschung bzieht sich weniger auf das bourdieu'sche Deutungsmuster von Erklärungen des einen durch das andere (Bsp. Erreichte Bildungstitel erklärt durch soziale Herkunft).
2.3.3.4. 4.Die Wahrnehmung des Dargestellten wird durch die Praktiken des Darstellens beeinflusst. In der neuen Bildungsforschung werden die gewählten Darstellungsformen und damit die konkrete Forschungspraxis auf ihre performativen Effekte hin thematisiert. Bei Bourdieu ist die Thematisierung der soziologischen Reflexivität anders codiert: 1. Als Konstruktion des sozialen gegenstandes; 2. als Soziale Genese von Feldern und Ideen und 3. als Verortung des Forschenden in diesen sozialen Räumen.
2.4. s. 141ff: Kann ein Studium den Habitus durchbrechen
2.4.1. s. 156 Familiäre Herkunft und die Beziehung zu den Eltern spielen beim Studium eine wichtige Rolle
2.4.2. s. 159: Vgl. dazu: Soziale UNgleichheiten und Konfliktlinien im studentischen Feld. -> Studierndenmilieus.
3. Wollin, Vedrana -Faktoren gelungener Integration
3.1. S. 84 Nauch, Diefenbach und Petri Ökonomisches Kapital hat wenig Einfluss
3.2. S. 84 Wieviel Humankapital vermuten Lehrer bei Migrationseltern?
3.3. S.86 Thema- Deutsch-Sprachförderung an Schulen
3.4. S. 88 Kenntnisse der Eltern über Bildungssystem als wichtiger Faktor
3.4.1. MIgrationseltern streben nicht bewusst geringeren Erfolg der Kinder an.
4. Amy Chua
4.1. Faktoren
4.1.1. 1. Das Überlegenheitsgefühl – die Gewissheit, zu einer Elite zu gehören, intellektuell und wirtschaftlich leistungsfähiger zu sein als der Rest der Gesellschaft.
4.1.2. 2. Tiefsitzende Unsicherheit. Sie wird einerseits durch den Erziehungsstil hervorgerufen, den solche Eliten typischerweise pflegen, andererseits durch die Ablehnung oder gar Bedrohung, die solche Gruppen meist von aussen erfahren. Die Höchstleistungen funktionieren da als eine Art Sicherheitsgarantie.
4.1.3. 3. Impulskontrolle: Spitzenleistungen sind ohne sie undenkbar, und eben sie wird in diesen Gruppen von Kindheit an trainiert.
5. Sarazin
5.1. gesisse Kulturen sind weniger Leistungsfähig
6. Kustor-Hüttl Weibliche Strategien Resilienz...
6.1. Frauen sind bildungserfolgreicher als migrierte Männer
6.2. Resilienz als Mythos der Unverletzlichkeit
6.3. s. 96 Projekt Raum gestalten
6.4. Methode
6.4.1. Interviews
6.4.1.1. Tiefenhermeneutische Interpreation Auwertung
6.4.1.1.1. Hier könnte man abschauen wie mans machen kann
6.5. Kulturelles Kapital als Problem
6.5.1. S. 92 Fast keine Ausländer sind Lehrer Wäre positiv für Integration
6.5.2. Sarrazin erwähnt im Vorwort Abwehrhaltung Deutschlands gegenüber Migration
6.5.2.1. Dies nicht Folge von falscher Information und tendentiöse Berichtserstattung sondern Fehlende Neugierde, Empathie, echte Gsichter
6.5.3. s. 84 Bezug zu Bourdieu - Habitus und kulturelles Kapital Bislang ist kulurelles Kapital aus Migration = negativ für Bildungsbarriere Bidungsmarkt als Schlachtfeld des Klassenkampfes
6.5.3.1. Ist schlechter Bildungserfolg von Migranten politsch begründet? Sind es die rechten Parteien, die dafür sorgen, dass Ausländer benauchteiligt bleiben?
6.5.4. s. 284 Mütter als Trangend für Mädchen
6.5.4.1. Aber: Auch hier Konflikte Bildungserfolg soll im Einklang mit den eigenen kulturellen Vorstellungen erfolgen
6.5.4.1.1. Weche Vorstellungen? Frauen an den Herd? Aber gut ausgebildet? Keine Spezialisierung?
6.5.4.1.2. Dieser Konflikt hat sich aber ach positv ausgewirkt. Autonomiebestrebungen werden auf Schule übertragen
6.5.4.2. Die
6.6. Resilienzfördernde Faktoren
6.6.1. S. 255 Wichtig ist, dass Eltern Brücke zur Schule schlagen können
6.6.1.1. Positiv ist, wenn die Eltern bereits einen Anpassungprozess durchgemacht haben.
6.6.1.2. Problem kann sein: Eltern wollen Aufstieg gar nicht?
6.6.2. S.90 Studie London - positiv sind vile Haltgebende Rahmenbedingungen - Wertschätzung, Verantwortung. Hohe Erwartungshaltungen an die SuS
6.6.3. S. 95 resilienzfördernd ist... hohe Erwartungshaltung Sorge und Unterstützung durch Lehrer Verwantwortung entstehen lassen Fürsorgliche, soziale Bindung entstehen lassen klare konsistende Grenzen - lernen möglich machen Schule soll auf Anforderungen im Leben vorbereiten.
6.6.4. S. 91 Skandinavien -gute Pisa Resultate- Viele Tagesschulen. kontinuierliche Zugehörigkeit. Kein Sitzenbleiben, Exklusion
6.6.4.1. auch Tischanordnung spielt eine Rolle
6.7. Begriff der Resilienz
7. Andreas Hadar, Sandra Hupka-Brunner: Geschlecht, Migrationshintergrund und Bildungserfolg.
7.1. s.9ff: Bildungsungleichheiten wie Migration und Geschlecht sollten nicht einzeln, sondern immer in Kombination betrachtet werden.
7.1.1. Interaktionen und wehselseitige Abhängigkeiten zwischen Achsen sozialer Ungleichheit.
7.1.1.1. s.162: Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheit nach ethnischer Zugehörigkeit
7.1.1.2. s.192: Multidimensionalität und Kontextabhängigkeit sozialer UNgleichheit
7.1.1.3. s.251 Konzeptionelles Modell der theoretischen Zusammenhänge der Ausbildungsbedingungen
7.1.1.4. s. 270: Bildungsungleichheiten beim Hochschulzugeng nach Geschlecht und MIgrationshintergrund
7.1.1.4.1. s.272: Vergleich Schweiz und Frankreich
7.1.2. Intersektionalitätenansatz
7.1.2.1. s. 191: Konzept der Intersektionalität sozialer Ungleichheit
7.1.3. s.20 Zunahme von weiblichen Migrantinnen
7.1.4. s.21 Migrantinnen und Migranten unterscheiden sich in: - sozialen - rechtlichen - ökonomischen Herkunfts- und Aufnahmebedingungen
7.1.5. s. 161: Ethnische Bildungsungleichheit
7.1.6. s.161f: Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheit
7.1.6.1. s.213: junge Frauen als Gewinnerinnen der Bildungsexpansion
7.1.6.1.1. s. 243: Übertrittsprobleme in die Berufsbildung
7.2. s.36ff: Faktische Definition schulischen Scheiterns
7.2.1. Erklärungen für die konzeptionelle Vermischung klassischer Ansätze zum schulischen Misserfolgdurch die Faktoren nationalstaatliche Herkunft und Geschlechterzugehörigkeit
7.2.1.1. Macht-Prestige-Relation
7.2.1.2. s.38: Unterschichtungseffekt
7.2.1.3. Hoffmann-Nowotony
7.2.1.4. Oswald
7.2.2. s.46: Der Einfluss der Herunftsnation, gemessen an sleketionsentscheiden, steht hinter dem Einfluss des Schulorts zurück.
7.2.3. s. 47: Der individuelle Bildungserfolg ist ein produkt der gesellschafltichen Kräfteverhältnisse im Wettbewerb um begehrte Bildungstitel
7.2.4. s. 137: Geschelchtsspezifische Leistungsdisparitäten
7.2.5. s.137f: Migrationsspezifische Disparitäten
7.2.6. s.140: Sekundäre Herkuntfseffekte
7.3. s. 52: Ungleiche Startvoraussetzungen zu Beginn der Schullaufbahn
7.3.1. s. 54: Kompetenzunterschiede nach migrationshintergrund.
7.3.2. s.55: Kopetenzunterschiede nach Geschlecht.
7.3.3. s.57: Ressourcen-Investitionsansatz
7.3.4. s.58: Geschlechterspezifische Sozialisation
7.4. s. 79: Wandel der Bildungschancen nach Geschlecht in der Schweiz
7.4.1. s.83: Benachteiligung der Knaben durch Lehrerinnen
7.4.2. s.245 Ausbildungsbedingungen im segmentierten Schweizerischen lehrstellenmarkt
7.5. s. 86: Soziale Selektivität
7.6. s.102: Differenzen in der Kompetenzentwicklung
7.6.1. s. 104: Geschlechtsrollen
7.6.2. s. 106: Marginalisierungs- und Diskriminierungserfahrungen
7.6.3. s. 107: Akkulturation und Identitätsbildung
7.6.4. s, 116: Studienergebnisse
8. Bourdieu
9. Gomolla- Radtke Institutionelle Diskriminierung verhindern
9.1. Formen der Diskriminierung
9.1.1. s.49 Konzept: Direkte und indirekte Diskriminierung
9.1.1.1. Eigenrationalität der
9.1.1.1.1. Schulen haben viel Spielraum wie sie Gesetze umsetzen etc.
9.1.1.2. S. 278 Mechanismus der direkter Diskri.
9.1.1.3. S. 281 Mechanismus der indirekten Diskriminierung
9.1.2. Gesetze (offensichtlich)
9.1.3. Ungeschriebene Gesetze (grosse Dunkelziffer - nur durch Statistiken messbar)
9.1.3.1. Sozial-konstruktivistisches Konzept: Art und weise wie z.b. Lehrer Probleme warnehmen sind stark davon abhängig, welche organisatorischen Möglichkeiten und Ressourcen vorherschen.
9.2. Selektion
9.2.1. um S. 145 Welche Rolle spielt die Jahrgangstärke- gibt es Quoten?
9.2.2. Barrieren für Migrationskinder:
9.2.2.1. Perfekters deutsch für Gymnasium vorausgesetzt
9.2.2.2. Sprache allgemein
9.2.2.3. kein unterstützendes Elternhaus
9.2.2.4. Ausländerquoten bei Gesamtschulen
9.2.2.5. S. 269 Schulen wollen möglichst homogene Klassen, die zusammen wie 1 Schüler unterrichtet werden können.
9.3. Weitere Probleme
9.3.1. Heterogenität wird nur als Problem gesehen. Mehr Aufwand!
9.4. Rassismus
9.4.1. S. 276 Was ist zuerst, Rassismus oder Diskriminierung Rassismus als Begründung für Diskriminierende Praktiken
9.5. S. 275 Definition von Institutioneller Diskriminierung
10. Politische Entscheide der letzten Jahre diesbezüglich
10.1. HARMOS
10.2. LP21
10.3. PISA
10.4. http://www.skbf-csre.ch/de/bildungsmonitoring/bildungsbericht-2014/
10.5. Literatur über die wichtigen Entscheide noch nicht gefunden.
10.6. Leitfaden/Position Erziehungsdepoartement zurBildungsdikriminierung.
10.6.1. PHBern
10.6.2. Verfassung
10.6.2.1. Siehe EDK
10.6.3. erz erz.be.ch
10.6.3.1. Integration und besondere Massnahmen
10.6.3.1.1. DaZ-Leitfaden: Präzisiert die verbindlichen kantonalen Vorgaben
10.6.3.1.2. Integrative Sonderschulung, Bedingungen: - Abklärungsbericht des Jugendpsychiatrischen Dienstes -> Kinder mit Behinderung haben das Recht auf angemessene Schulbildung. DIes kann integrativ in der Volksschule geschehen. -> Nichts mit MIgrationshintergrund zu tun.
10.6.3.1.3. BMV: Verordnung über die besonderen Massnahemn in der Volksschule
10.6.3.2. Migration und Integration
10.6.3.2.1. Merkblätter für
10.6.3.2.2. Einschulung von neuzuziehenden Kindern und Jugendlichen aus Durchgangszentren erfolgt grundsätzlich in eine Regelklasse.
10.6.3.2.3. HKS. Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur
10.6.3.2.4. Leitfaden: Umgang mit kulturellen und religiösen Symbolen und Traditionen in Schule und Ausbildung
10.6.3.2.5. Erziehungsberatung: - Familienberatung - Beratung für Jugendliche
10.6.3.3. Das Wort Bildungsdiskriminierung findet sich auf der Erz-Seite nirgends.bildungsdiskriminierung
10.6.4. Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation
10.6.5. EDK
10.6.5.1. St + B 34A: Koordination des Sprachenunterrichts in der Schweiz --> "Umfassendes Verständnios von Sprachenlernen"
10.6.5.2. Bundesverfassung Art 62-64: Migration und allfällige Diskriminierung sind nicht erwähnt, Sonderschulung behinderter Kinder hingegen schon.
10.6.5.3. Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schulen vom 14.06.2014
10.6.5.3.1. Art. 2 Abs. 2: Kantone sind bestrebt, die schulischen Hindernisse für eine nationale und internationale Mobilität der Bevölkerung zu beseitigen.
10.6.5.3.2. Art 4. Abs 4: HSK-Kurse sind verbindlich
10.6.5.3.3. Art. 7 Abs 2: Zwei Arten von Bildungsstandards: - Leistungsstandards pro Fachbereich basierend auf einem Referenzrahmen mit Kompetenzniveaus. - Standards, welche Bildungsinhalte und Bedingungen für die Umsetzung im Unterricht umschreiben.
10.6.5.4. EDK-Empfehlungen zur Schulung fremdsprachiger Kinder vom 24.10.1991
10.6.5.4.1. Art. 1: ... Jede Diskriminierung ist zu vermeiden....
10.6.5.4.2. Art. 2: - Förderunterricht - Unterricht in der Heimatsprache - Übertritt in weiterführende Schulen erleichtern durch Förderangebote - ausserschulische Hilfe anbieten - LP aus und fortbilden bezgl. Umgang mit Multikulturellen Klassen etc, etc...
10.6.5.4.3. Art. 2: in der Schülerbeurteilung, bei Promotions- und Selektionsentscheiden die Fremdsprachigkeit und das Mehrwissen in der heimatlichen Sprache und Kultur angemessen zu berücksichtigen. Vor allem ist zu vermeiden, dass fremdsprachige Schülerinnen und Schüler nur aufgrund mangelnder Kenntnisse in der Unterrichtssprache in Hilfs- und Sonderklassen eingewiesen werden oder ein Schuljahr wiederhoen müssen
10.6.6. GEF
10.6.6.1. Leitfaden/leitsätze
10.6.6.1.1. Integration ist ein prozess
10.6.6.1.2. Integration betrifft alle gesellschaftsmitglieder
10.6.6.1.3. Integration orientiert sich an Ressourcen
10.6.6.1.4. Integration ist ein bewusster Umgang mit Differenzen
10.6.6.1.5. Integration bedeutet Fördern und Fordern
10.6.6.2. Umsetzungsebene
10.6.6.2.1. Bildung
10.6.6.3. Integrationsprogramm 2014-17
10.6.6.3.1. Förderbereich Diskriminierungsschutz
10.6.6.3.2. Förderbereich Sprache und Bildung
10.6.6.3.3. Förderbereich frühe Förderung
10.6.7. SKBF (koordinationsstelle für Bildungsforschung)
10.6.7.1. Bildungsbericht Schweiz 2014
10.6.7.1.1. Ist 60 Seiten lang, keine Zeit jetzt ;)
10.7. Hierzu Interview ?
11. Ioannidou - Steuerung im trannationalen Bildungsraum
11.1. S. 35. Bildung als nur beim Nationalstaat liegendes. Prozesse wie "educational borrwing and lending" stellen Steuerung durch Nationalsstaat in Frage
11.1.1. S. 38 Begriff "Governance"
11.2. s. 47. Wie steuert die EU und OECD Deutschland? Bildungsmonitoring und -Berichterstattung Benchmarking "S. 36-Eu zum besten etc. wissenbasirten Wirtschaftsraum machen".
11.3. Offene Fragen
11.3.1. Führt der Einfluss von EU und OECD im schweizer Bildungssystem zu einer stärkeren Diskriminierung von Ausländern?
11.3.2. Auf welche Weise beeinfluss die OECD das Schweizer Bildungssystem?
12. s. 26: Zwischen SuS in Sonderklassen und SuS in Regelklasse sind erhebliche Leistungsüberschneidungen festgestellt worden. --> Der Entscheid zur Einteilung in eine Sonderklasse hängt nur selten nachweisbar vom meritokratischen Prinzip ab.
13. Doris Edelmann- Bildung im Transnation.....
13.1. Beschreibung des Programm Quims
13.2. Typenbildung (S.189) von Lehrern. wie gehen sie mit Heterogenität um?
13.2.1. subjektive Interpretation sowie persönliche Interessen beinflussen Umgang mit heterogenen Klassen sehr
13.2.2. Dialektik der Differenz: S. 223 Partikularitäts- vs. Universalitätsorientierung. Alle einbeziehen (auch Ausländer) oder für alle Gleiche bedingungen?
13.2.2.1. Lehrpersonen können sich nicht nicht positionieren!
13.2.3. S. 201 Faktoren bei Lehrer die integration erleichtern "" erschweren
13.2.4. Es kommt auf den Lehrer drauf an
13.2.5. Wie wird mit Eltern zusamengearbeitet?
13.3. pädagogische Konsequenzen
13.3.1. Prioritäre Themenbereiche
13.3.2. Von "Ausländerpädagogik" zu "Pädagogik der Vielfalt"
13.3.3. Schule kann nicht alles alleine machen
13.4. Lehrpersonen mit Migrationshintergrund
13.4.1. wie beeinflussen Sie das Kollegium, wie handhaben sie eine Klasse?
13.5. Leherbildung
13.5.1. ist immer mehr gefördert
13.5.1.1. Was macht Kanton Bern, PHBern?
13.5.2. Tertiärisierung als Chance
14. Bernhard Bueb -Lob der Disziplin
14.1. s.15 Gärtner (wachsen lassen) oder Töfper (formen). Zwei Erziehungsstile treten gegeneinander an.
14.1.1. Nach Krieg (Hitler) wollte man (D) Nation von Gärtnern sein
14.2. Die Familie ist nicht alles
14.2.1. S. 125
14.2.2. S. 125
15. Winfired Kronig - Die systematische Zufälligkeit des Bildungserfolgs
15.1. Standortabhängigkeit des Bildungserfolgs
15.1.1. S.15, 17ff: Bildungserfolg in der Schweiz ist in erheblichem Umfang durch standortabhängige Faktoren mitstrukturiert.
15.1.1.1. s.218: Die Bildungskarriere von SuS mit Migrationshintergrundsteht in engerem Zusammenhang mit ihrem Wohnkanton als mit ihrem Herkunftskland
15.2. Zeitabhängigkeit des Bildungserfolgs: Bildungschancen zwischen immigrierten und einheimischen Kindern gleicht sich über die Zeit nicht zwingend an.
15.2.1. s.23 Grafik Sonderklassenzuweiseungen udn Nationalitäten.
15.3. s.25f: Verletzung des meritokratischen Prinzips (= Herrschaftsordnung bei der Amsträger (=Herrscher) aufgrund ihrer Leistung gewäühlt werden).
15.4. s.31: Auf Faktoren, welche den individuellen Bildungserfolg ausmachen, haben SuS kaum Einfluss. Vom Individuum aus betrachtet kann Bildungserfolg also als Zufällig erachtet werden.
15.4.1. Angebotsstruktur
15.4.2. Selektionsstruktur
15.5. s.37: Der Einfluss der Struktur des Bildungssystems
15.5.1. Die Abiturientenquote hat sich ab 60/70er vervierfacht.
15.5.1.1. --> Bildungsexpansion
15.5.1.2. s. 38, Picht 1964: Bildungswettlauf um Konjunturchancen zu steigern.
15.6. s. 49: Verwertungschancen von Bildungsabschlüssen im späteren Berufsleben
15.6.1. Inflationierung von Bildungstiteln
15.6.1.1. s.52: Das Paradoxon: Bildung wird immer wichtiger, Bildungsabschlüsse werden aber entwertet.
15.6.1.1.1. s.58: Für jene, die in den unteren Etagen des Bildungssystems festsitzen, überweigen die Nachteile der Bildungsexpansion. Sie müssen unter verschlechterten sozialen Lernbedingungen einen stark entwerteten Bildungstitel erwerben.
15.6.2. Entkoppelung von Bildungs- und BEschäftigungssystem
15.6.3. Verdrängung niederer Bildungsabschlüsse vom Arbeitsmarkt
15.7. s.59: Bildungserfolg als vorhersehbares Ergebnis strukturbedingter Reproduktion
15.7.1. Georg Simmel (1908, s.236): Soziale Positionen werden nicht erworben, sondern sie werden zugewiesen
15.7.1.1. s. 66: Bourdieu et al.: Forderung nach rationaler Päödagogik: Kulturelle und soziale BEnachteiligungen effizient und bewusst erfassen und durch entpsrechende Massnahmen ausgleichen.
15.8. s.70: Individaultheroetische Ansätze: Konzentration auf die Handlungsmöglichektien des Individuums.
15.8.1. Bildung als kumuliertes Ergebnis individueller Entscheidungen
15.8.1.1. s. 76: Rational-Choice-Theorie
15.8.1.1.1. Kritik: Niemand handelt nach RC, sondern affektgesteuert, unlogisch, situationsabhängig, traditionsorientiert etc..
15.8.2. s.72: Modelle der Humankapitaltheorie
15.8.2.1. --> Entscheidungsfreiheit der Individuen finden ihr Ende an strukturbedingetn Faktoren.
15.9. s.119: Es gibt keine pauschale Antowrt auf die Frage, wie gross der Beitrag von der Schule bei der Herstellung von Bildungsungleichheiten ist.
15.10. s.123ff:Studiendaten: Kulturelle und leistungsbezogene Heteorgenität in Schulklassen - Emprirsche Studien über günstige und ungüsntige Konstellationen.
15.10.1. natinalstaatliche Herkunft
15.10.2. soziale Herkunft
15.10.3. inhaltliche Kompetenzen
15.11. s.155 Heterogenität, Leistungssteigerung und Leistungsausgleich
15.11.1. Jeder Aufstieg eins SoS wird erkauft durch den Abstieg eins anderen.
15.11.2. s.155ff: Dilemma: Intensivierung der Leistungsangleichung kann eine Verlangsamung des allgemeinen Leistungfszuwachses bewirken.
15.11.2.1. Die Auswirkung von Unterrichtsmethoden oder Klassenzusammensetzung kann nur bedingt nachgewiesen werden: Es gibt sowohl varianzsteigernde wie auch varianzsekndene Elemente.
15.11.2.2. 2 Zielebenen im Konflikt: - Leistungssteigerung - Leistungsanpassung
15.11.3. s. 169: Die Leistungsschere wird nicht in allen Klassen im gleichen Umfang vergrössert.
15.11.3.1. 1/3 der KLassen kann die Eingangsstreuung reduzieren
15.11.3.2. 2/3 der Klassen lassen jedoch eine Dipsersionszunahme erkennen.
15.12. s. 171: Die Schulklasse als Lernbedingung
15.12.1. Coleman (1966): Das durch die Komposition der Klasse generierte Lernumfeld ist der wichtigste Schulfaktor für die Leistungssteigerung.
15.12.1.1. s.176ff: Studie zur Lernentwicklung in unterschieldichen Schulklassen:
15.12.1.1.1. s. 183: Die Ergebnisse zur Wirkung der Schulklasse auf den Lernfortschritt sind uneinheitlich....
15.12.1.1.2. s.183: Bei SuS aus Zuwandererfamilien ist das meritokratische Problem besonders ausgeprägt.
15.12.1.1.3. s. 183: Kinder aus privilegierten Familien gelingt es im Verlauf der Primarschulzeit, ihren Startvorsprung zunehmend in einen grösser werdenenden Leistungsvorsprung umzusetzen
15.12.1.1.4. s.183: Schulisches Lernen setzt grundlegende Qualifikationen voraus. Dies benachteiligt SuS aus unterprivilegierten Familien.
15.12.1.1.5. s. 183: Soziale und nationalstaatliche Herkunft sollten in der Bildungsforschung weiterhin getrennt betrachtet werden.
15.12.1.2. s.221: Je höher das aggregierte Kompetenzniveau einer Schulklasse, desto grösser sind (in der MAthematik, vgl. Studie) die gemessenen Lernfortschritte.
15.13. s.184: Leistung und Leistungserwartung
15.13.1. s.191: Erwartungseffekte (von Lehrpersonen an SuS) sind langfristig nur bei Kindern aus zugewanderten und unterprivilegierten Familien nachzuweisen
15.14. s.192ff: Leistungsbewertung/selektion: Zufall und Systematik
15.14.1. Beim Prüfergebnis werden nur die Fähigkeiten des Kanditaten beurteilt, nicht aber die Arbeit des Prüfers.
15.14.2. Mangelhaftigkeit der schulischen Bewertungspraxis
15.14.2.1. dysfunktional
15.14.2.2. von zahlreichen Fehlerquellen verfälscht
15.14.2.3. institutiionalisierte UNgerechtigkeit
15.14.2.4. Für die Selektion absolut untauglich
15.14.2.5. s. 193: Objektivitätswahn
15.14.2.6. s.193: Kult um die Schulnote
15.14.2.7. psychometrische Anfälligkeiten der Leistungsbeurteilung
15.14.2.7.1. Halo-Effekt
15.14.2.7.2. Reihungseffekt
15.14.2.7.3. Kontrasteffekte
15.14.2.7.4. Beurteilungstendenzen
15.14.2.7.5. Beobachtungsmängel
15.14.2.7.6. Erinnerungsfehler
15.14.2.7.7. logische und mathematische Artefakte, welche unkontrolliert in die Beurteilung einfliessen
15.14.2.7.8. --> Aus Sicht des Beurteilten kommt dies einer Zufälligkeit gleich
15.15. s. 210: Die Selektionsentscheiode sind daher ebenfalls all diesen Faktoren unterlegen
15.15.1. Selektionsentscheide sind von Herkunftsmerkmalen beeinflusst.
15.15.1.1. s. 214 Der Einfluss von pädagogischen MAssnahmen auf die Bildungsbiographie ist beschränkt. --> Referenzgruppenfehler
15.15.1.2. s. 215: Der Zusammenhang zwischen Selektionsentscheiden und der sozialen Herkunft ist unverantwortlich eng.
15.15.2. s. 215: Die Legitimation der Schule als Zertifizierungs- und Allokationsinstitution wird angezweifelt. (Allokation = Zuteilung, Einordnung)

