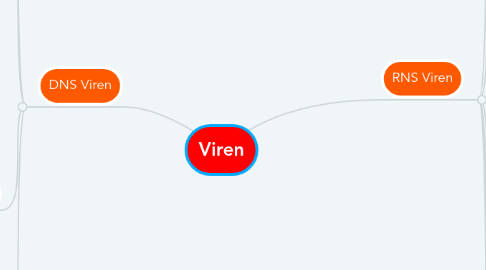
1. DNS Viren
1.1. Papillomaviren → unbehüllt, doppelsträngig
1.1.1. 100 Typen
1.1.2. Über Läsionen → Epithelzellen Haut und Schleimhäute
1.1.3. Unkontrolliertes Tumorartiges Wachstum → Warzen, Zervixkarzinom
1.1.4. Antiproliferative Hemmung zelluläre Proteine → oberste Zellschicht stirbt durch virale Replikation ab → Zelltod, freisetzung infektiöser Viruspartikel
1.1.5. Genitale Papillomaviren
1.1.5.1. Low Risk → Warzen im Genitalbereich = Feigenwarzen
1.1.5.2. High Risk → Zervixkarzinom, Afert und Mund, Produktion Tumorsupressorproteine
1.1.6. Konjunktivalpapillome
1.1.7. Impfstoff: Gardisil → Schutz vor einigen Serotypen
1.2. Adenoviren → unbehüllt, doppelsträngig
1.2.1. 47 Serotypen
1.2.2. Keratokonjunktivitis epidemica
1.2.3. Hämorrhagische Konjunktivitis
1.3. Herpesviren → behüllt, doppelsträngig
1.3.1. Vermehrung Lymphozyten, Nervenzellen oder epidermalen Zellen
1.3.2. Persistenz möglich
1.3.3. Herpes Simplex 1 und 2
1.3.3.1. Nur Mensch ist Wirt
1.3.3.2. Vermehrung Epithelzellen
1.3.3.3. Fusion benachbarter Zellen, Zerstörung Wirtszelle und Freisetzung neuer Virone
1.3.3.4. Eindringen Nervenenden sensibler Neurone → retrograd axonal
1.3.3.5. Gigivostomatitis = Mundfäulnis, Ösphagitis, Enzephalitis, Keratitis
1.3.3.6. Herpes genitales → Präputium, Glans, Vulva, Vagina
1.3.3.7. Herpes neonatorum = Herpes Neugeborenen → schwere Enzephalitis
1.3.4. Varicellovirus
1.3.4.1. Windpocken und Gürtelrose (= Zoster)
1.3.4.2. Persistent in Spinalganglien
1.3.4.3. Eintrittspforte: Schleimhäute oberen Respirationtrakt, Konjunktiva
1.3.4.4. Replikation regionale Lymphknoten → Milz, Leber → Schleimhäute
1.3.4.5. Hauteffloreszenz
1.3.4.6. Kontagiös, aerogen
1.3.5. Epstein–Barr–Virus → Pfeiffer Drüsenfieber = Mononucleosis infektiosa
1.3.5.1. Inkubationszeit 2–8 Wochen
1.3.5.2. Fiber, Lymphknotenschwellung, Anina, Gliederschmerzen, Milz– und Leberschwellung, Bauch–, Muskel– oder Kopfschmerzen, Appetitlosikeit, Depression, allgemeine Schwäche
1.3.5.3. Dauer Wochen bis Monate
1.3.5.4. Eintrittspforte: Schleimhäute, Küssen
1.3.5.5. Vermehrung in Epithel Oropharynx, Zervix (= Mandeln)
1.3.5.6. Lebenslang persistent
1.4. Hepatitis–B–Viren
1.4.1. Akut, chronisch
1.4.2. Erbrechen, Übelkeit, evt. Gelbsucht
1.4.3. 80% heilender Verlauf, 20% → chronische Hepatitis → Zirrhose → Hepatitis Karzinom
1.4.4. Inkubationszeit 4–12 Wochen
1.4.5. Vermehrung Leberzellen
1.4.6. Blut, Blutprodukte, Sexualverkehr, kleinste Mengen notwendig → nur Mensch
1.4.7. Expositionsprophylaxe, Immunisierung
2. RNS Viren
2.1. Picronaviren → unbehüllt, einzelsträngig, + polar
2.1.1. Enteroviren
2.1.1.1. Fäkal–Oral, per os, Lebensmittel, Wasser, 1. Vermehrung Rachenraum → Darmwand → Blutweg → Zielorgan
2.1.1.2. Mensch reservoir
2.1.1.3. Meistens asymptomatisch
2.1.1.4. Poliviren
2.1.1.4.1. Lebendimpfstoff Sabin, Totimpfstoff Salk, 10 Jahre Schutz (Expositionsrisiko)
2.1.1.4.2. 3 Serotypen → Kinderlähmung
2.1.1.4.3. Zielzellen: Motorische Neurone Vorderhörner, Rückenmark, Hirnrinde → Zytolose
2.1.1.4.4. Spinale Form → schlaffe Lähmung, bulbopontine Form → Hirnnerven 5, 6, 7
2.1.2. Hepatoviren A
2.1.2.1. Virusvermehrung Darm → Leber
2.1.2.2. Gutartig, nicht chronisch
2.1.2.3. Übertragung Lebensmittel, Schmier, Schutzfunktionen, schlechte hygienschie Verhältnisse
2.1.2.4. Aktive Immunisierung: Totimpfstoff
2.1.2.5. Erbrechen, Bauchschmerzen, Gelbsucht
2.1.2.6. Resistente Viren
2.1.3. Rhinoviren
2.1.3.1. Schnupfen
2.1.3.2. Epithel Nasenschleimhaut zerstört → Rhinitis (= Entzündung Nasenschleimhaut)
2.1.3.3. Inkubationszeit bis 4 Tage
2.1.3.4. Bakterielle Superinfektion häufig → keine Reaktivierung Kälte und Nässe
2.1.3.5. Kleinkinder → Bronchitis, Bronchopneumonie
2.1.3.6. Tröpfcheninfektion
2.1.3.7. 114 Serotypen
2.1.3.8. Expositionsprophylaxe
2.2. Orthomyxoviren → behüllt, einzelsträngig, – polar, RNA Genom auf mehreren Segmenten verteilt (Anpassung)
2.2.1. Influenza A (8), Influenza B (8), Influenza C (7)
2.2.2. Hämagglutinin (H 14), Neuraminidase (N 9) → Oberflächenantigene
2.2.3. Reassortment bei Doppelinfektion
2.2.4. H → andocken an OF Wirtszelle, N → Verhindert Verklumpen neues Viruspartikel oder mit Mucin (Lipidhülle, müssen es durchdringen)
2.2.5. Antigenic Drift = kleinere Veränderungen → Punktmutationen Hämagglutinin
2.2.6. Antigenic Shift = grössere Veränderungen
2.2.7. Aerogene Übertragung → Vermeherung Schleimhäute Nasopharynx → Pharyngitis, Tracheobronchitis, Pneumonie
2.2.8. Bakterielle Superinfektionen möglich → früher Tod, Heute Tamiflu (A und B)
2.3. Flaviviren → behüllt, + polar, einzelsträngig
2.3.1. Übertragung von Arthropoden
2.3.2. 1. Phase → Kopf–, Fieber–, Muskelschmerzen, Virämie → 1–3 Tagen entweder Krankheit beendet oder 2. Phase
2.3.3. 2. Phase →
2.3.3.1. FSME = Frühsommer–Meningoenzephalitis → Kinder: akute Meningitis ohne Spätfolgen, Erwachsene: Meningoenzephalitis mit Somnolenz, Psychosen, Koma, Totimpfstoff
2.3.3.2. Gelbfieber = hämorrhagisches Fieber → schädigung Leber, Niere, Gerinnungsstörungen, Lebendimpfstoff
2.3.3.3. Dengue Fieber
2.3.3.4. West–Nil Fieber → Meningitis, Enzephalitis
2.3.3.5. Hepatitis C
2.3.3.5.1. Posttransfusion
2.3.3.5.2. Chronisch → Leberzirrhose → Leberkarzinom
2.3.3.5.3. Expositionsprophylaxe, keine Impfung
2.4. Rhabdoviren
2.4.1. Lyssavirus → Tollwut
2.4.1.1. Vermehrung Eintrittspforte (Muskel) → entlang Nervenfaser ZNS (Virusvermehrung) → periphere Organe → Speicheldrüse, Kornea, Niere → Enzephalitis
2.4.1.2. Hornhauttransplantate Menschen
2.4.1.3. 1. Stadium = Prodromalstadium → Kribbeln, Brennen, Übelkeit, Erbrechen, melanchonische Verstimmung
2.4.1.4. 2. Stadium = Exzitationsstadium → Krämpfe, Spasmen Pharynx und Larynx, Hydrophobie, Wutanfälle, Schlagen, Beissen
2.4.1.5. 3. Stradium = aufsteigende Paralyse → Tod durch Asapyxie
2.4.1.6. Lange Inkubationszeit → postexpositionelle Impfprophylaxe durchgeführt
2.4.1.7. Biotopsie und Korneaabklatsch
2.5. Retroviren → einzelstrang, +polarität
2.5.1. Reserve Transkriptase → Information +RNA in DNS (Wirt) übertragen
2.5.2. Delaretovirus
2.5.2.1. HTLV 1, HTLV 2 → T–Zell–Leukozytenanämie
2.5.3. Lentivirus
2.5.3.1. HIV 1, HIV 2
2.5.3.2. Befall CD4 Marker Molekül
2.5.3.3. 1. Phase → Inapparent, Pfeiffer–Drüsenfieber ähnlich
2.5.3.4. 2. Phase → Latenzphase → Zerstörung CD4 Helferzellen
2.5.3.5. 3. Phase → AIDS
2.5.3.5.1. A und B → asymtomatische Zeichen
2.5.3.5.2. C → AIDS definierenden Erkrankungen
2.5.3.6. Intrauretin = innerhalbn Gebärmutter, perinatal = vor Geburt
2.6. Togaviren → behüllt, einzelsträngigen, + polar
2.6.1. Rubivirus, Rubellavirus
2.6.1.1. Röteln → hellrote Flecken, exanthemische Erkankung, mildes Fieber
2.6.1.2. Tröpfcheninfektion
2.6.1.3. Schwangere
2.6.1.3.1. Rötelnembryopathie
2.6.1.4. Aktive Immunisierung

