Nationaler Aktionsplan Behinderung
par Anja Strobl
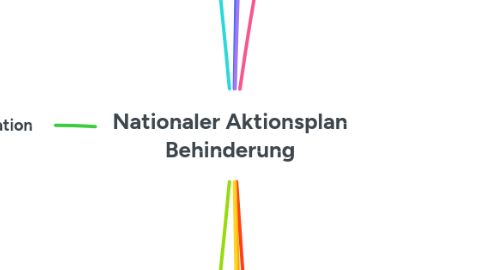
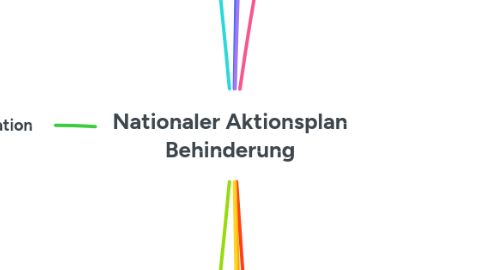
1. Selbstbestimmtes Leben
2. Gesundheit und Rehabilitation
2.1. Was sind die Aufgaben des Nationalen Aktionsplans? Der Nationale Aktionsplan Behinderung dient der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und verfolgt das Ziel, eine Inklusive Gesellschaft zu schaffen, in welcher Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt und selbstbestimmt leben können. Wie ist die Ausgangslage? Menschen mit Behinderung ist die Gesundheitsversorgung in voller Bandbreite, Qualität und Höhe zur Verfügung zu stellen. Menschen mit Behinderung haben in Österreich vollen Zugang zu allen Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung und Unfallversicherung. Das Leistungsangebot bezieht sich auch auf alle somatischen und Psychischen Erkrankungen unabhängig von Ursache, Ausmaß und Dauer. Die Barrierefreiheit ist ebenfalls bereits mitinbegriffen, wäre aber in Bezug auf bauliche Barrierefreiheit, barrierefreier Kommunikation, geschultem Personal und bedarfsgerechten Öffnungszeiten ausbaufähig. Zielsetzung und Indikator Ziel: Umfassende Barrierefreiheit soll in allen Gesundheitseinrichtungen und bei sämtlichen niedergelassenen Vertragsärzten hergestellt werden. Indikator: Prozentualer Anteil der umfassend barrierefreien intramuralen Einrichtungen und Praxen von Vertragsärzten Im Bereich der Psychotherapie soll die Sachleistungsversorgung mit dem langfristigen Ziel der Bedarfsdeckung stufenweise ausgebaut werden. Indikator: Anzahl der jährlichen kassenfinanzierten Psychotherapiestunden (Sachleistungsversorgung) Welche Maßnahmen trifft man? Schaffung einer entsprechenden Datengrundlage, um auf die Bedarfe von Menschen mit Behinderungen in der Sozialversicherung eingehen zu können. Ist-Stands-Erhebung zu „Barrierefreies Gesundheitswesen“ unter Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen und Erfahrungsexperten als Ausgangspunkt zur Erstellung eines Etappenplans. Kwich Jonas, Gorditsch Margit
3. Bewusstseinsbildung und Information
4. Was ist die Ausgangslage meines Themas („Barrierefreies Wohnen“)? Warum ist das Thema wichtig? · Menschen mit Behinderungen haben laut Artikel 9 UN-BRK das Recht auf gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, u. a. zu Wohnungen, Schulen und Arbeitsstätten. · In Österreich sind derzeit nur 13 % der Wohnungen barrierefrei oder zumindest anpassbar. · Das Baurecht ist Ländersache, daher gibt es keine einheitlichen Vorschriften (z. B. ab wann ein Lift erforderlich ist). · Besonders bei Eigentumswohnungen gibt es große rechtliche Hürden für bauliche Anpassungen. · Viele Menschen kennen sich mit barrierefreiem Bauen nicht aus – Fachwissen und Beratung fehlen. · Es braucht daher gesetzliche, bauliche und finanzielle Verbesserungen, um selbstbestimmtes Wohnen und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Indikatoren (zur Erfolgsmessung): · Anteil barrierefrei nutzbarer oder anpassbarer Wohnungen. · Anzahl von Kompetenz- und Beratungsstellen in den Bundesländern. · Verfügbarkeit und Nutzung von Wohnbauförderungen für barrierefreies Bauen und Adaptieren. Ziele und Schwerpunkte im NAP: · Der barrierefreie und anpassbare Wohnbau soll forciert werden. · Kompetenz- und Beratungsstellen für barrierefreies Bauen sollen in allen Bundesländern eingerichtet werden. · Schwerpunkt liegt auf: o Neubau barrierefreier Gemeindewohnungen, o Nachrüstung von Altbauten, o rechtlicher Vereinfachung (z. B. Wohnungseigentumsgesetz), o Verknüpfung mit Fördermaßnahmen. Welche Maßnahmen möchte man treffen? Im Zeitraum 2022–2030 sind folgende Maßnahmen geplant: 1. Barrierefreie Errichtung von Gemeindewohnungen, laufende Nachrüstung von Altbauten und Ausbau bestehender Wohnungen. → Zuständig: Alle Bundesländer → Kosten: Werden bei der Budgetmittelaufteilung festgelegt 2. Verknüpfung der Wohnbauförderung mit barrierefreiem bzw. anpassbarem Wohnbau; Ausweitung der Förderungen zur Adaptierung von Wohnungen. → Zuständig: Alle Bundesländer → Kosten: ebenfalls bei Budgetmittelaufteilung festzulegen
5. Behindertenpolitik
5.1. • Einbindung der Länder in die Erstellung des NAP (Nationales Institut zur Förderung und Schutz der Menschenrechte) • Einführung einer Task-Force in den Bundesländern – übergreifend zu Themen Partizipation • Sicherstellung der Partizipation von Menschen mit Behinderungen • Sicherung der Finanzierung von Maßnahmen • partizipative Erstellung von Indikatoren unter Heranziehung wissenschaftlicher Expertise Definition Behinderung Behinderung entsteht aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren, die sie an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern. Wenn es um konkrete Rechtsfolgen geht, wird allerdings in vielen Bestimmungen auf einen so genannten Grad der Behinderung abgestellt. Dies betrifft z. B. die Zugehörigkeit zum der Begünstigten Behinderten und damit den Zugang zu Förderungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Dieser Grad der Behinderung wird überwiegend nach medizinischen Kriterien gemäß der so genannten Einschätzungsverordnung ermittelt. Zielsetzung: 1B) Der Zugang zu Leistungen für Menschen mit Behinderung soll sich nach dem tatsächlichen Unterstützungsbedarf und nicht nach prozentualen Werten (basierend auf medizinischen Faktoren) richten. Soziale Kriterien sollen in der Bemessung der Bedarfe von Menschen mit Behinderungen einfließen. Maßnahmen: Ausrichtung aller Definitionen von Behinderung in den Landesgesetzen nach dem menschenrechtlichen Modell von Behinderung nach der UN-BRK.
6. Gleichberechtigung/ Diskriminierung
6.1. Behindertengleichstellungsrecht Ausgangslage: Seit 2006 besteht ein Behindertengleichstellungsgesetz in dem ein weitreichendes Diskriminierungsverbot beinhaltet ist. Auch die Länder haben auch eigene Nichtdiskriminierungsgesetze, wobei der Diskriminierungsschutz nicht in allen Ländern umfassend ausgelastet ist. 2013 wurde der Rechtsschutz für Menschen mit Behinderung verbessert. Ziel: - Verbesserte Rechtssicherheit - Informationen über das Behindertenrecht sollen niederschwellig und barrierefrei sein - Unterstützungsmöglichkeit soll durch Behindertenanwalt erweitert werden Maßnahmen: - Verstärkte Sensibilisierung der Richter:innen - Veröffentlichung wesentlicher Entscheidungen in leichter Sprache - Unterstützung durch Behindertenanwalt Erwachsenenschutzrecht Ausgangslage: „Gleiche Anerkennung vor dem Recht“ Anerkennung als Rechtsobjekt, um dies zu gewährleisten, bedarf es Unterstützungsmaßnahmen und Schutzmechanismen. Wille der Person an erster Stelle. 2018 wurde das Erwachsenenschutzgesetz reformiert. Damals Sachwalterrecht. Ziele: - Unterstützung bei der selbstständigen Entscheidungsfindung - Verstärkung des Wissens über einen gewählten ESV - Akzeptanz der eigenständigen Handlung von Menschen mit Behinderung Maßnahmen: - Ausbau der Angebote zur unterstützenden Entscheidungsfindung - Förderung der Erwachsenenschutzvereine - Förderung der Kenntnis über Erwachsenenschutzrecht Schutz vor Gewalt und Missbrauch Ausgangslage: Im Artikel 16 im UN-RK sind die Vertragsstaaten verpflichtet Vorkehrungen zu treffen um Menschen mit Behinderung vor jeder Art der Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch zu schützen. Menschen mit Behinderung haben ein erhöhtes Risiko für Aussetzung an Gewalt und Missbrauch, deshalb soll Prävention ab Kindesalter stattfinden. Ziele: - Leicht zugängliche Informationen und Unterstützung zum Thema Gewalt - Gewaltschutzkonzepte in den Einrichtungen Maßnahmen: - Broschüren für Opfer - Maßnahmen zum Schutz vor sexueller Gewalt – Sensibilisierung der Mitarbeiter:innen in den Einrichtungen
6.1.1. Ronja Sauer Martina Wadel Joanna Feurer
7. Barrierefreiheit
7.1. Aufgaben des Nationalen Aktionsplanes sind es zum Thema Selbstbestimmung • Unterstützungsleistungen auszubauen und flexibel zu gestalten, um den Menschen möglichst viel eigenen Gestaltungsraum wie sie wohnen, arbeiten und ihre Freizeit gestalten möchten, zu ermöglichen • Teilbetreutes Wohnen soll forciert und gegenüber dem Bereich vollbetreutes Wohnen ausgebaut werden • Beratungsangebote, Strategien der De-Institutionalisierung sollten partizipativ erarbeitet werden • Ausbau von persönlichen Unterstützungsleistungen und Freizeit-und Familienassistenz Ausgangslage zum Thema: • Allgemein sind MmB in den Bereichen Wohnen, Arbeit und Freizeitgestaltung oftmals fremdbestimmt und werden rein institutionell begleitet Maßnahmen: • Zeitliche Begrenzung des zivilrechtlichen Unterhaltsanspruchs der volljährigen Kinder gegenüber den Eltern 2022-2024 • Schaffung selbstbestimmter und inklusiver Wohnformen 2022-2030 • Partizipative und gemeinsame Erarbeitung eines Konzepts für Beratungsangebote 2026 • Partizipative Erarbeitung der De- Institutionalisierung, ab 2023 • Ausbau / qualitative Weiterentwicklung der Selbstvertretungsstrukturen 2022 -2030
8. Bildung
8.1. Ausgangslage: Unterschiedliche Regelungen je nach Bundesland Indikatoren (Schwerpunkte) und Ziele: Ausbau von inkl. Bildungs- und Ausbildungsangeboten Kooperation Bund, Länder, Gemeinden und Sonderpädagogik Optimierung Übergang Arbeitsmarkt Weiterentwicklung der Qualität durch Bildung und Ausbildung inklusionspädagogischer Kompetenzen Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung inkl. Sprachbewusstsein Laufende wissenschaftl. Begleitung Maßnahmen: Guidelines, Verhandlungen zw. Bund, Länder und Gemeinden Bildungsdirektion mit Fachbereich Inklusion, Diversität Kompetenzzentren für Inklusionspädagogik Evaluierung Vergabepraxis SPF Multiprofessionelle Teams Steigerung der Bildungsabschlüsse Bildungscontrolling und Bildungsmonitoring Diversitätskompetenz in Direktionen ausbauen und erweitern Lehrpläne kompetenzorientiertes Lernen Rechtliche Verankerung weiterer Ausgleichsmaßnahmen Sonderschullehrer als Leitung
8.1.1. Astrid Schmidtbauer Astrid Gogg
