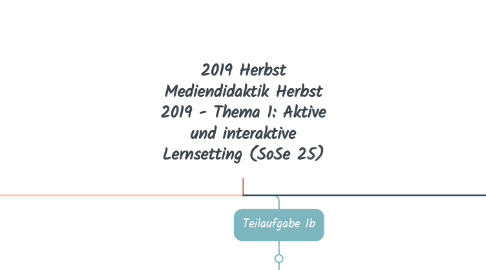
1. Thema
2. Einleitung
2.1. Nach dem ICAP-Modell gibt es verschiedene Qualitätsstufen kognitiver Lernprozesse, die nach beobachtbaren Lernaktivitäten eingestuft werden. Je höher die Qualitätsstufe, desto effektiver kann der Wissenserwerb sein. „ICAP“ ist die Abkürzung der verschiedenen Stufen: Interactive-Constructive-Active-Passive Das Modell wird von unten nach oben gelesen, d.h. „passiv“ ist die niedrigste und „interaktiv“ die höchste Stufe der Schüleraktivität (slt)
3. Teilaufgabe 1a
3.1. aktives Lernsetting
3.1.1. Nach dem ICAP Modell werden die Lernenden in aktiven Lernsettings werden selbst tätig (slt)
3.1.1.1. Beispiele: Notizen anfertigen, markieren, Inhalte produzieren (Podcasts, Videos, Präsentationen), recherchieren, bewerten, bearbeiten (slt)
3.1.1.1.1. Kognitive Prozesse: Die Lerninhalte werden integriert, reproduziert und organisiert. Die Lernaktivitäten gehen jedoch nicht über die im Lernmaterial präsentierten Informationen hinaus (slt)
3.2. interaktives Lernsetting
3.2.1. Nach dem ICAP Modell agieren die Lernenden in interaktiven Lernsettings untereinanander oder mit digitalen Medien/Computer (slt)
3.2.1.1. Beispiele: Diskussion, Fragen stellen und beantworten, Rückmeldung, Feedback, Austausch in einem Forum - soziale Komponente (slt)
3.2.1.1.1. Kognitive Prozesse: Durch interaktive Lernaktivitäten werden Argumente und Vorstellungen anderer Personen in die eigene Sichtweise integriert und individuelle Wissenslücken werden geschlossen (slt)
3.3. (Digitales) Lernsetting
3.3.1. KIM und JIM-Studien: Kinder und Jugendliche kommen im Alltag ständig mit Medien in Kontakt -> Schule muss mediale Erfahrungen aufgreifen, einordnen und didaktisch nutzen (S. Tiegs)
3.3.1.1. Strategie "Bildung in der digitalen Welt" (KMK 2016): "zunehmende Digitalisierung aller Lebensbereiche" S. 8 -> auch in der Bildung -> entsprechende Kompetenzen fördern, um SuS auf die Herausforderungen der Zukunuft vorzubereiten (S. Tiegs)
4. Teilaufgabe 1b
4.1. Relevanz der Lernsituation von SuS für den Einsatz digitaler Medien
4.1.1. digitale Medien
4.1.1.1. Digitale Medien sind für die Umsetzung des ICAP-Modells nicht zwingend notwendig, ermöglichen jedoch, dass die nächsthöhere Stufe leichter und schneller erreicht wird und die Umsetzung effektiver ist (slt)
4.1.1.1.1. Lernen mit informations- und kommunikationstechnischen Medien (ICT); Lernen mit Internet, Computer, Tablet-Pc, Smartphone etc. Kennzeichen: Interaktivität Adaptivität Multimedialität Leutner, Opfermann, Schmeck, 2014, S. 299) (JBM)
4.1.2. Relevanz der Lernsituation von SuS für den Einsatz dig Med.
4.1.2.1. Lernniveau der SuS beachten z.B. E-I-S-Prinzip nach Bruner (Enaktiv, ikonisch, symbolisch) -> Primärerfahrungen auf enaktivem Niveau können nicht durch Sekundärerfahrungen (ikonisch / symbolisch vermittelt) ersetzt werden (S. Tiegs)
4.1.2.1.1. Herzig (2014) "Wie wirksam sind digitale Medien im Unterricht?" bedeutenster Faktor für die Vorhersage von Lernerfolg (sogenannter Prädiktor): thematisches und medienbezogenes Vorwissen (S. 20) weitere Faktoren: Selbststeuerung, Lernstrategien, Motivation, Interesse "bildungssoziologische Kategorien" (z.B. kulturelles Kapital) nehmen indirekt Einfluss (S. Tiegs)
4.1.3. Bezug zu mediendidaktischen Theorien
4.1.3.1. ICT: Lernförderliche Effekte der Interaktivität kognitive Aktivierung und tiefere Informationsverabeitung Beispiele - eigene Entscheidung, wann man zur nächsten Seite/Sequenz klickt - Pausieren von Lernvideos/Animationen --> bessere Erinnerungs- und Transferleistung - Bilder vergrößern können - Hyperlinks ermöglichen nichtlinaere Informationsabrufung --> eigene Lerngeschwindigkeit und Vorlieben Drag-and Drop --> Verknüpfungen zwischen Text und Bild selber herstellen (Leutner, Opfermann, Schmeck, 2014, S. 299) (JBM)
4.1.3.1.1. Multimedialität: multiple Repräsentationsformen und die daraus resultierende Verarbeitung über verschiedene Sinneskanäle (Leutner, Opfermann, Schmeck, 2014, S. 301) (JBM)
4.1.4. Bezug zu Konzepten der Lehr-Lernforschung
4.1.4.1. • Interaktive Möglichkeiten nehmen von Behaviorismus über Kognitivismus zu Konstruktivismus zu (S. 51).
4.1.4.1.1. o Behaviorismus (Lernen durch Reize und Reaktionen) : festgelegte Lernwege (Roznawski, 2013, S. 47) eingeschränkte Interaktion, meist lineare (Computer)Programme, die einfaches Feedback geben (Roznawski, 2013, S. 50)(JBM)
5. Teilaufgabe 2
5.1. Inwiefern kann aktives und interaktives Lernen mit dig. Medi. im Vergleich zum traditionellen Unterricht ohne dig. Med. den Lernprozess positiv beeinflussen?
5.1.1. Digitale Medien können sowohl das fachliche Lernen als auch fächerübergreifende Kompetenzen mit kleinen bis mittelgroßen Effekten fördern. •Effektivität variiert je nach Einsatzform und Kontext. Alle Folgende Ergebnisse wurden aus Fischer, Wecker, Stegmann, 2015, entnommen Digitale Medien zeigen einen kleinen positiven Effekt auf den Lernerfolg (Effektstärke 0.30 bis 0.37). Hattie (2009) (JBM)
5.1.1.1. Größere Effekte bei kognitiv aktiven (z.B. Notieren) und konstruktiven Tätigkeiten (z.B. Argumentieren). o Digitale Präsentationen: Effektstärke 0.11 o Animationen: Effektstärke 0.37 o Serious Games: Effektstärke 0.30-0.35 o Kognitive Tutoren: Effektstärke 0.44-0.50 o Interaktive Videos: Effektstärke 0.50 o Concept-Mapping-Anwendungen: Effektstärke 0.82 Höffler & Leutner (2007), Wouters et al. (2013), Kulik & Fletcher (2015), Nesbit & Adesope (2006) Höhere Effektstärken bei anspruchsvolleren Maßen wie dem Entwickeln eigener Positionen (Effektstärke 0.90). Hattie (2009) (JBM)
5.1.1.1.1. Höhere Effekte bei digitaler Unterstützung des Unterrichts im Vergleich zu eigenständigen Lernprogrammen. Tamim et al. (2011) (JBM)
5.2. Bezug zu mediendidakischen Theorien
5.2.1. Multimediaeffekt: kognitive Verarbeitung von Wörtern und Bildern ist besser als von Wörtern allein; Effektstärke zwischen 0.45 und 2.43 (Leutner, Opfermann, Schmeck, 2014, S. 306) --> aber nur visueller Kanal Digitale Medien ermöglichen eine leichte Präsentation von Wort und Bild in Farbe, die von jedem Schüler im eigenen Tempo bearbeitet werden kann, was im herkömmlichen Unterricht oft nicht geleistet werden kann, z.B. aufgrund fehlender Farbkopierer, fehlender Annimationsmöglichkeit, Kein Zoomen etc. ) (JBM)
5.2.1.1. Modalitätseffekt: man lernt besser anhand von Bildern und gesprochnen Wörtern als anhand Bilder und geschriebene Wörter --> visueller und auditiver Kanal (Leutner, Opfermann, Schmeck, 2014, S. 307) Digitale Medien vereinfachen die Präsentation von gesprochenen Wörtern und Bildern vor allem hinsichtlich des unterschiedlichen Arbeitstempos, da sonst lediglich die gesprochenen Wörter von Lehrkräften oder Mitschülern zu Trage kommen würden, die allerdings zu einem gleichen Zeitpunkt für alle erfolgen --> dann aber Problem von Kontiguitätseffekt (Bild und Wort müssen zeitlich und räumlich nahe beiander liegen, sonst Überlastung des Arbeitsgedächtnises) (JBM)
5.2.1.1.1. Signalisierungseffekte: man lernt besser, wenn auch zentrale Punkte, die für das Lernen bedeutend sind, hingewiesen wird --> weniger kognitive Kapazität nötig (Leutner, Opfermann, Schmeck, 2014, S. 309) Markierungen im Text auch ohne digitale Medien möglich, aber digitale Medien eröffnen weitere Möglichkeiten: Hinweisepfeile während Animationen, schrittweise Freischaltung von relevanten Inhalten, akustische Signale, Feedback (JBM)
5.3. Bezug zu Konzepten der Lehr-Lernforschung
5.3.1. siehe 1b: Steigerung der Motivation durch Erfüllung der Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz & soziale Einbindung (Selbstbestimmungstheorie nach Deci & Ryan 1985 / 2022) (S. Tiegs)
6. Teilaufgabe 3:
6.1. Unterrichtssequenz mit aktiven oder interaktivem Lernsetting unterstützt durch den Einsatz EINES digitalen Mediums um fachbezogene Kompetenzen zu erwerben
7. Aber Expertise-Umkehr-Effekt beachten: hohes Vorwissen kann Lernen negativ beeinflussen/multimediale Effekte ins Gegenteil umkehren --> Interaktivität und Adaptivität beachten (Leutner, Opfermann, Schmeck, 2014, S. 311) (JBM)
8. Bitte recherchieren Sie in der Examensliteratur und der zusätzlichen Literatur im Gripskurs relevante Themenbereiche!
8.1. Ergänzen Sie anschließend die Mindmap mit Ihre Ideen
8.1.1. Geben Sie BEI JEDEM EINTRAG die Quelle und Seitenzahl mit an!!!
